Hanks Welt
Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).
Aktuelle Einträge
25. Juni 2025Vom New Deal zum Real Deal
08. Juni 2025Geld her!
27. Mai 2025Wer stoppt Trump?
10. Mai 2025Ein Herz aus Stammzellen
14. April 2025Lauter Opportunisten
07. April 2025Die Ordnung der Liebe
29. März 2025Streicht das Elterngeld
17. März 2025Der Kündigungsagent
17. März 2025Hart arbeiten, früh aufstehen
04. März 2025Kriegswirtschaft
20. Oktober 2021
Anreize zum Impfen
Peitsche schlägt Zuckerbrot
Meine zweite Corona-Impfung habe ich mir von meinem HNO-Arzt spritzen lassen. Vergangene Woche traf ich den Doktor und fragte ihn, wie viele Impfwillige derzeit durchschnittlich in seine Praxis kämen. »Praktisch keiner mehr«, antwortete der Arzt und berichtete von einem Patienten, den er als besonders klug beschrieb, der sich standhaft einer Impfung widersetze und sich zur Rückversicherung seiner Weigerung nächtelang in die Lektüre komplexer Studien vergrabe. Den Einwand des Arztes, angesichts der vielen erfolgreichen Impfungen hätte man wohl von gravierenden Nebenwirkungen gehört haben müssen, schlägt der Impfverweigerer in den Wind: »Die halten das alles unter Verschluss«, entgegnet er, wobei er mit »die« böswillige Regierungskreise meint.
Der Fall lässt Zweifel aufkommen an der Behauptung unseres Chefvirologen Christian Drosten, die Impfbereitschaft sei eine Funktion des Bildungsgrads. Recht hat Drosten zweifellos, wenn er sagt, das Schließen der »Impflücke« sei das A und O der Pandemiebekämpfung. Wer sich impfen lässt, schützt seinen Mitmenschen und sich selbst. Wenn sich gut 80 Prozent der Bevölkerung über 12 Jahre impfen ließen, würden Covid-19 und seine Mutanten ihren Schrecken verlieren. Zu kooperieren ist sowohl altruistisch wie egoistisch gesehen ziemlich rational.
Den Impfgegner meines HNO-Arztes wird man damit nicht erreichen. Er hat sich gegen die Logik der Kooperation immunisiert und bleibt ein kluger Tor. Offenbar führen Informationen nicht zu Verhaltensänderungen. Kein Wunder, dass in vielen Ländern, darunter auch Deutschland, die Impfquote seit geraumer Zeit bei gut 60 Prozent stagniert. Die Erfahrung spricht indes dafür, dass die nicht Geimpften keine unbelehrbaren Hardcore-Widerständler sind. Zumindest die Hälfte der heute noch Ungeimpften könnte für die Spritze gewonnen werden. Doch wie?
Wenn Aufklärungskampagnen nicht zum Erfolg führen, dann bringen Ökonomen gerne das Zauberwort »Anreize« ins Spiel. Anreize sind Signale, die außerhalb einer Person liegen. Sie wirken, indem sie Menschen zu einem bestimmten Verhalten veranlassen. Anreize können zwar keine Wunder bewirken, aber kooperatives Verhalten zum Nutzen aller in die Wege leiten und Trittbrettfahren weniger attraktiv machen.
Man unterscheidet positive von negativen Anreizen. Im Deutschen geht es um Zuckerbrot (wer weiß eigentlich noch, was das ist?) oder Peitsche; im Englischen um »stick or carrot«. Seit sich die Impfzentren leeren, aber immer noch viele ungeimpft sind, wird ausprobiert, ob und wenn ja welche Anreize helfen. Dass die Impfgegner dies als »Impfpflicht durch die Hintertür« abtun, sollte man ihnen nicht durchgehen lassen. Anreize sind keine deterministischen Automatismen. Wer nicht will, braucht sich nicht pieksen zu lassen. Er muss freilich Nachteile in Kauf nehmen oder kann Vorteile nicht nutzen, kann womöglich nicht ins Restaurant, ins Kino oder zur Sonntagsmesse gehen.
Mich interessiert, ob negative oder positive Anreize zielführender sind. Soll man Impfverweigerer bestrafen oder sie belohnen, damit sie sich umentscheiden? Oder sogar beides? Dafür bietet die Corona-Welt derzeit den Verhaltensökonomen frei Haus empirisches Material. Intuitiv würden viele Menschen die Belohnung der Bestrafung vorziehen. Das ist vermutlich eine der Pädagogik früherer Zeiten entstammende Präferenz: Dem Kind ist die Tafel Schokolade allemal lieber als die Tracht Prügel.Dass der Staat zur Belohnung fürs Impfen Geld in die Hand nimmt, ist dann gerechtfertigt, wenn dadurch höhere Pandemiekosten vermieden würden. Simulationen haben allerdings ergeben, dass es schon ziemlich viel Geld sein muss, bevor die Zauderer sich ins Impfzentrum bewegen. Zudem könnten Impfgegner sich bestätigt fühlen: Wenn der Staat eine Prämie aussetzt, wird womöglich an der Sache doch etwas nicht ganz koscher sein. Versuchspersonen in der Pharmaindustrie zahlt man ja auch Geld, um ein unsicheres Medikament an Mann und Frau zu bringen. Und schließlich könnten die freiwillig Geimpften es unfair finden, dass ihr kooperatives Verhalten nicht belohnt wurde, während ganz Clevere darauf spekulieren, die Prämie werde erhöht, wenn sie nur lange zuwarten.
Vor- und Nachteile einer Impflotterie
Eine ganze Reihe dieser Nachteile würde eine Impflotterie vermeiden, für die der Kölner Spieltheoretiker Axel Ockenfels gewisse Sympathien hegt: Alle Bürger nehmen automatisch an der Lotterie teil. Die ausgelosten Gewinner erhalten einen Geldpreis – aber nur dann, wenn sie bereits geimpft sind. Das Design dieser Lotterie macht sich die verhaltensökonomische Einsicht zunutze, dass Menschen Verluste schlimmer finden als Gewinne: Wer sich nicht impfen lässt, dem könnte ein beträchtlicher Geldbetrag entgehen. Ockenfels bezweifelt jedoch, ob mit Lotterien viel zu machen wäre. Daten aus den USA legen nahe, dass der Effekt auf die Impfquote gering und nur von kurzer Dauer ist. Auf Dauer nützt sich »Nudging« (»schubsen«) ab.
Hinzu kommt ein grundsätzlicher Einwand gegenüber Belohnungen, auf den mich der Bonner Verhaltensökonom Matthias Sutter aufmerksam macht: Der Mensch, wie er nun mal so ist, gewöhnt sich an die Belohnungen und nimmt sie irgendwann als selbstverständlich (und verdient) wahr. Damit Belohnung wirkt, muss sie ständig eingesetzt werden (was sehr kostspielig ist) und sie müsste sogar gesteigert werden, um den gleichen Effekt zu behalten, weil sich die Leute daran gewöhnen. Das verbraucht am Ende ganz schön viele Karotten. Wenn wir in der Zukunft in eine Situation kommen, wo wir alle sechs bis neun Monate eine Auffrischungsimpfung brauchen, könnte Belohnung langfristig schlecht wirken und zugleich teuer werden.
Von Bestrafung dagegen versprechen sich die Ökonomen deutlich bessere Verhaltensänderungen. Um den Anschein der harten Peitsche zu mildern, sprechen die Wissenschaftler von »altruistic punishment«, womit die freundliche Abmahnung im Interesse der Allgemeinheit gemeint ist. Der Vorteil der Bestrafung gegenüber der Belohnung besteht darin, dass das Damoklesschwert der Strafe auch schon ohne seine Anwendung eine abschreckende Wirkung entfaltet: »Und bist Du nicht willig!« In den Laborversuchen der Wissenschaftler bestrafen die Versuchspersonen ihre Mitspieler nur sehr, sehr selten, es genügt ihnen, die Option zu haben, das Verhalten durch Strafen in die »richtige« Richtung lenken zu lenken, berichtet Sutter.
Das Ergebnis ist wenig schmeichelhaft für die menschliche Natur: Eine Bestrafung wirkt effizienter als eine Belohnung. Schon ihre Androhung macht gefügig. Wer nicht geimpft ist und deshalb in Quarantäne muss, steht künftig ohne Lohn und Gehalt da. Das ist bislang die teuerste Peitsche, die der Staat schwingt. Zusätzlich könnte man die Tests verteuern oder 2G statt 3G zur Zutrittsschranke im öffentlichen Leben machen. Wenn die Anreiztheorie Recht hat, müsste dann die Impfquote hoch gehen.
Rainer Hank
11. Oktober 2021
Wenn Bayern sich selbständig macht
Ein Gedankenspiel über das Recht der Minderheiten
Nehmen wir einmal an, die Bundestagswahl an diesem Sonntag führte zu einem Ergebnis, das viele inzwischen für nicht unwahrscheinlich halten: Unter der Führung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) kommt es zu einer rot-grün-roten Koalition. Zwar hat Scholz sich eine Weile lang rührend um die FDP bemüht. Doch die Gespräche scheitern am Ende an der Finanzpolitik. Während die Liberalen sich standhaft gegen die Einführung einer Vermögenssteuer, die Anhebung der Einkommensteuer und die Lockerung der Schuldenbremse wehren, läuft der SPD-Mann mit seinen Steuervorschlägen bei den Linken offene Türen ein.
Nehmen wir zusätzlich an – was viele für ebenfalls nicht völlig unwahrscheinlich halten -, die Berliner Initiative zur Enteignung großer Wohnungskonzerne hätte auch Erfolg und ein neuer rot-rot-grüner Senat in der Hauptstadt unter Führung von Franziska Giffey käme gar nicht darum herum, das demokratische Votum der Mehrheit in ein Gesetz zu gießen und die Vergesellschaftung des Immobilienbestandes in Angriff zu nehmen. Anschließend fände das Enteignungsgesetz auch im Kabinett Scholz rasch viele Freunde.
Nehmen wir also an, es käme so auf vollkommen demokratische Weise zu diesem Wahlausgang, dann wäre es nicht übertrieben zu sagen, wir befänden uns danach in einer anderen, nämlich linken Republik, in der das Privateigentum nicht mehr geachtet, die Erfolgreichen konfiskatorisch ausgenommen und – auf Drängen der Grünen – mit Blick auf den Klimawandel stärkere Eingriffe in die Bewegungsfreiheit der Bürger an der Tagesordnung wären.Ich will hier keine »Rote-Socken-Angst« schüren. Mir geht es um eine rechtsphilosophische Frage: Welche Möglichkeit haben Minderheiten, sich gegen den Willen der Mehrheit zur Wehr zu setzen. Die naheliegende Antwort lautet: Gar keine. So ist es eben in einer Demokratie. Die Unterlegenen haben sich der Mehrheit zu beugen. Sie können dafür werben, dass bei der nächsten Wahl wieder ihre Leute an die Macht kommen, die den Sozialismus zurückdrängen. Würden sie zwischenzeitlich sehr ungeduldig, bleibt es ihnen unbenommen, in ein liberaleres Land (zum Beispiel in die Schweiz) auszuwandern. Demokratie, so schrieb Alexis de Tocqueville vor bald zweihundert Jahren, ist eine Art Diktatur der Mehrheit. Da kann man nichts machen.
Renaissance des Sezessionismus
Kann man wirklich nicht? Der Einzelne hat aus guten Gründen wenig Möglichkeiten, ihm nicht behagende Wahlergebnisse zu korrigieren. Doch wie ist es mit größeren Gebietskörperschaften? Nehmen wir in unserem Gedankenexperiment jetzt noch an, anders als die rot-grün-rote Mehrheit im Bund würde es in Bayern unter Führung des charismatisch kraftstrotzenden Heroen Markus Söder zu einer satten Mehrheit der CSU kommen. Das würde den alten Gegensatz zwischen München und Berlin wieder aufleben lassen, nicht zuletzt, weil zu befürchten wäre, dass die rot-grün-roten Steuer- und Klimapläne vor allem die erfolgreichen Unternehmen und Wirtschaftsbürger Bayerns (und Baden-Württemberg, aber das wäre ein anderes Thema) träfen. Kein Wunder, dass in Folge davon alte sezessionistische Ideen im Freistaat eine Renaissance erleben. Einer vor vier Jahren veröffentlichten Umfrage des britischen Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge wünscht sich ein Drittel der Bayern die Unabhängigkeit von der Bundesrepublik Deutschland. Die Bayernpartei hält diesen Autonomiegedanken seit Jahren am Leben.
Wie legitim sind separatistische Auf- und Ausbrüche in Demokratien? Bayern, spätestens seit der Reichsgründung 1871 ein Volk ohne Nation, könnte sich an Katalonien und Schottland ein Beispiel nehmen: Katalonien kämpft seit langem gegen die Dominanz der spanischen Zentrale. Und Schottland, latent separatistisch seit dem »Act of union« mit England im Jahr 1707, träumt neuerdings wieder von einer Abspaltung, nachdem das Vereinigte Königreich sich seinerseits mit dem Brexit aus der Europäischen Union verabschiedet hat. Allemal geht es um die schwierige Balance zwischen Zentrale und Peripherie und ihre ethnisch (darf man das bei Bayern sagen?) oder sozialpsychologisch unterschiedlich tickenden Bevölkerungen. Sagen wir so: In Berlin ist man es gewohnt, vom Rest der Republik alimentiert zu werden. In München (gewiss auch in Stuttgart) hat man gelernt, dass das Geld erst verdient werden muss, bevor man es ausgeben kann. Kein Wunder also, dass der Freistaat aufmuckt und ein freier Staat werden will.
Abspaltungen von Staatsteilen werden hierzulande verunglimpft als nationalistisch-engstirnige Kleinstaaterei. Dass diese Verunglimpfung latent von einem imperialen (wenn nicht imperialistischen) Gedanken zehrt, wird zumeist übersehen. Als ob immer engere Integration – »ever closer union«, wie es in den EU-Verträgen heißt – ein Ziel an sich wäre! Stets gilt es abzuwägen, wie hoch die Integrationskosten im Vergleich zum Nutzen des Großstaates sind. Staatenbünde und Bundesstaaten sind kein Selbstzweck. Ihre Legitimation steht dann infrage, wenn Minderheiten zu viel abverlangt wird.Ein Blick auf Georg Jellinek
Der Gedanke des Minderheitenschutzes in einer Demokratie wurde ausgerechnet in jenem 19. Jahrhundert entwickelt, das als Jahrhundert des kolonialen Imperialismus gilt. Er speist sich aus zwei philosophischen Quellen: Dem Liberalismus, dem das Selbstbestimmungsrecht der Menschen wichtig ist. Und einem Romantizismus, der den organischen Zusammenhalt in einer Gesellschaft betont (ich empfehle einen Ausflug in dass großartige neue Romantik-Museum in Frankfurt am Main). Man gewinnt nichts, hier immer gleich niederen Nationalismus zu wittern. Georg Jellinek, ein Anfang um 1900 in Heidelberg lehrender österreichischer Staatsrechtler, ist der Ansicht, die Demokratie sei eine Gefahr für Minderheiten. Das nimmt der Idee der Solidarität ihre moralische Unschuld. Jellinek schreibt 1898: »Je weiter die Demokratisierung der Gesellschaft vorwärtsschreitet, desto mehr dehnt sich auch die Herrschaft des Majoritätsprinzips aus. Je mehr das Individuum durch den Gedanken der Solidarität zurückgedrängt wird, desto weniger Schranken erkennt der herrschende Wille gegenüber dem Einzelnen an.« Die Anerkennung von Rechten der Minderheiten wirkt als heilsames Korrekturprinzip gegenüber der Übergriffigkeit demokratischer Mehrheiten.
Lassen wir die Kirche im Dorf. Wir halten es nicht für sehr wahrscheinlich (aber eben auch nicht für völlig ausgeschlossen), dass es in Berlin zu rot-grün-rot kommt. Wir halten es noch weniger für wahrscheinlich, dass Bayern in den kommenden vier Jahren die Bundesrepublik verlässt. Doch es kann nicht schaden, an einem Wahlsonntag das liberale Erbe in Erinnerung zu rufen, demzufolge der Bürger stets zwei Möglichkeiten hat, sich in einer Demokratie zu artikulieren: Mit seiner (Wahl)stimme (»voice«) und mit der Handlung, allein oder mit anderen auszuwandern (»exit«). Ohne Minderheitenschutz ist keine gute Demokratie zu machen.
Rainer Hank
20. September 2021
Lauter kleine Kapitalisten
Ein Vorschlag, das Problem teurer Mieten zu lösen
Deutschland ist ein Land der Mieter. Die Wohneigentumsquote stagniert, obwohl Wohneigentum im vergangenen Jahrzehnt erheblich an Attraktivität gewonnen hat. Zwar sind die Preise von Immobilien kräftig gestiegen. Doch auf der anderen Seite hat die Zinsentwicklung die Preisentwicklung vielerorts überkompensiert, wie es in einer neuen Analyse des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) heißt.
Statt zu kaufen, jammern die Deutschen lieber. Statt selbst zu kleinen Kapitalisten zu werden, wollen sie die Groß-Kapitalisten enteignen.
Knapp die Hälfte der Deutschen nennen ein Häuschen oder eine Eigentumswohnung ihr eigen. Die andere Hälfte wohnt zur Miete. In Berlin ist es besonders krass: Dort sind über achtzig Prozent der Menschen Mieter. Nirgendwo in Europa gibt es so wenig Wohneigentümer wie in Deutschland. »Immobilienvermögen ist der Schlüssel zu einer gleichen Vermögensverteilung in Deutschland«, lese ich in einer neuen Studie des »Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung« (DIW). Kein Wunder, dass die Deutschen weniger vermögend sind als Spanier oder Italiener.
Das alles ist merkwürdig. In Befragungen sagen viele junge Deutschen, sie wünschen sich eine eigene Wohnung. Warum sie den Wunsch nicht umsetzen, ist unklar: Komplizierte Genehmigungsverfahren werden genannt, hohe Kosten für Makler, Notare und eine unfaire Grunderwerbsteuer. Ein Haus zu finanzieren ist ein Wagnis – wenn man angesichts der zögerlichen Bautätigkeit denn überhaupt eines findet. Der Staat, der hierzulande für alles und jedes sich zuständig erklärt, fühlt sich für den erleichterten Zugang zu erschwinglichem Wohneigentum nicht wirklich verantwortlich. Lieber wird jetzt wieder viel über Sozialwohnungen geredet – ein Konzept aus der sozialdemokratischen Mottenkiste; da wohnen in der Regel die Falschen, viel zu lange und zu viel zu günstigen Preisen.
Ein Blick nach Singapur
Wenn Wohnen »die neue soziale Frage« ist, wie man derzeit – völlig übertrieben – hört, schlage ich vor, den Blick nach Asien zu richten. Vergangene Woche war ich in Singapur. Das Land öffnet sich, nachdem man sich achtzehn Monate lang fast hermetisch von der Außenwelt abgeschirmt hat, um das Corona-Virus abzuschrecken – was dann doch nicht ganz geklappt hat. Singapur hat die höchste Eigentümerquote auf der ganzen Welt. Sie liegt bei über achtzig Prozent. Das ist die umgekehrte Relation verglichen mit Berlin. In Singapur lässt sich ein gelungenes Sozial-Experiment studieren, wie aus Mietern oder Wohnungslosen Eigentümer werden – und das unter erschwerten Bedingungen. Der Stadtstaat beherbergt auf einer Fläche, die gerade einmal doppelt so groß ist wie Bremen, inzwischen 5,7 Millionen Menschen (in Bremen sind es rund 600 000). In den sechziger Jahren, als der neue Staat gegründet wurde, zählte man lediglich 1,6 Millionen Menschen. Das Land zieht seither wie ein Magnet Menschen aus der ganzen Welt an. Das führte zu einer extremen Wohnungsnot.
Die Regierung parierte die Krise mit drei genialen Maßnahmen. Erstens gelang es, dem Meer in enormem Umfang Land abzugewinnen: damit vergrößerte sich die Fläche des Staates von 580 Quadratkilometern im Jahr 1965 auf 728 Quadratkilometer 2020.
Zweitens erklärte der Staat sich dafür zuständig, in großem Stil serielle Wohnungen zu bauen. »Seriell« muss nicht bedeuten, dass diese Wohnungen so unwirtlich aussehen, wie unsere Trabantenstädte in Neuperlach & Co. In den Häusern aus den sechziger Jahren, die wir uns in Singapur angeschaut haben, gibt es viel »Co-Living-Space« für die Bewohner, eine Idee, die auf der gerade stattfindenden Architektur-Biennale in Venedig als Zukunftsvision gepriesen wird. Singapur achtet auch auf eine gesunde soziale Mischung der Eigentümer, um eine Ghettobildung zu vermeiden.
Drittens schließlich kümmert der Staat sich um die Finanzierung der Wohnungen. Eine Wohnungsgesellschaft – das Housing and Development Board (HDB) – entwickelt die Bauprojekte. Entstanden sind im Lauf der Jahre über eine Million Wohnungen, die der Staat auf 99 Jahre den Bürgern überlässt. Die Appartements werden zu subventionierten Preisen und nach bestimmten Prioritäten an Singapurer Bürger verkauft. Gibt es mehr Anspruchsberechtigte als Wohnungen werden die knappen Eigenheime verlost – ein ökonomisch faires Verfahren.
Auch von der Schweiz lässt sich lernen
Jeder einheimische Bürger sollte Eigentümer werden können, so lautete die Devise des charismatischen Staatsgründers Lee Kuan Lew. Die staatliche Rentenkasse, in die jedermann Monat für Monat vierzig Prozent des Einkommens für Alter und Krankheitsschutz einzahlen muss, gewährt einen Kredit, der bis zu 90 Prozent des Hauspreises finanziert. Im Verlauf des Arbeitslebens muss dieser Kredit vom Eigentümer zurückgezahlt werden. Frühestens nach fünf Jahren können die Wohnungen zu Marktpreisen weiterverkauft werden. Das passiert häufig und ist ein Weg, wie Angehörige der unteren Mittelschicht ziemlich reich werden können. Eine Zweizimmerwohnung etwa, die vom Staat in den sechziger Jahren für 5000 Singapur-Dollar angeboten wurde, ist derzeit für 220 000 Dollar auf dem Markt – eine unschlagbare Rendite. Mit dem Erlös lässt sich trotz überhitztem Immobilienmarkt eine hübsche Wohnung in einem schicken Mehrparteienhaus (Condominium) erwerben.
Wem Singapur zu ostasiatisch klingt, der soll sich in der Schweiz umsehen. Dort haben sogar im Land lebende Nichtschweizer das Recht, aus ihrer kapitalgedeckten Altersvorsorge AHV Geld zur Finanzierung eines selbst genutzten Eigenheims zu entnehmen. Das ist dann eine Art Vorbezug seiner Altersersparnisse.
Man wird das Modell Singapur oder Schweiz nicht jeweils eins zu eins auf Deutschland übertragen können. Wichtig ist mir der Grundgedanke: Wenn der Staat sich um das Wohnen seiner Bürger kümmern will, dann ist es besser, er verhilft ihnen zu Eigentum als zu Mietsozialwohnungen. Dreh- und Angelpunkt ist der Zugang zu Kapital. Weil es in Deutschland keine kapitalgedeckten Pensionsfonds gibt, sondern lediglich die gesetzliche Rente, die als Umlage funktioniert, müssen wir uns hier etwas anderes einfallen lassen. Das IW empfiehlt zinslose oder zinsgünstige Kredite, die über eine Immobilienkreditversicherung abgesichert werden und die etwa im Fall von Arbeitslosigkeit, Scheidung oder dem Tod eines Partners die Weiterzahlung der Raten sicherstellt. Das würde die Scheu vor der hohen Verschuldung reduzieren.
Aus einer eigenen Wohnung kann einen kein Immobilienhai vertreiben. Man hat Vermögen und für das Alter vorgesorgt. Klingt super. Bleibt die Frage, warum die Eigentumsbildung in den Programmen der Parteien unter »ferner liefen« vorkommen. Da kann ich nur spekulieren: Eine lang gepflegte politische Stimmung des Antikapitalismus fürchtet sich vor einem Volk von lauter kleinen Kapitalisten.
Rainer Hank
17. September 2021
Destruktion hat Zukunft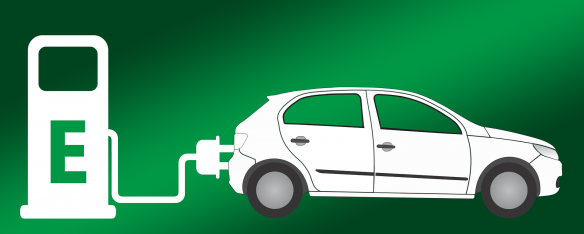
Keine Angst vor der Transformation
So viel Transformation war nie. Wir hören viel von der »digitalen Transformation«, der »großen Transformation«, der »biologischen Transformation« – und natürlich der grundlegenden Transformation unseres Wirtschaftens angesichts der von der Klimakrise bedrohten Welt.
Was versteht man unter Transformation? Eine erste Definition lautet: Transformation bezeichnet das Umwandeln oder Umgestalten von etwas in einen anderen Zustand. Es geht um die Umstrukturierung eines bestehenden Systems in ein anderes. Kaum ein Begriff hat in letzter Zeit eine solche Karriere hingelegt wie die Transformation. Anschaulich zeigt dies die Wortverlaufskurve des digitalen Wörterbuches der deutschen Sprache: Nach dem Jahr 2010 erlebt die seit 1946 flach verlaufenden Linie ein exponentieller Schub, der sie steil, fast vertikal, ansteigen lässt. Sofern Sprache etwas mit der Wirklichkeit zu tun hat, muss man sagen: Irgendetwas passiert. Aber was?
Transformationen sind mit Ängsten verbunden. Veränderungen mögen theoretisch willkommen sei, wird es konkret, fürchten wir sie. Unser Wohlstand – oder der unserer Kinder – ist gefährdet. Unsere Arbeit könnte uns ausgehen. Kein Wunder, dass Industrie und Gewerkschaften an den Staat und die Politik die Forderung herantragen, die Transformation abzufedern und potenzielle Verlierer zu entschädigen.
Machen wir es konkret am Beispiel der Automobilindustrie – passend zur IAA in München. Die Branche befindet sich weltweit in einem der größten Transformationsprozesse seit den Erfindungen von Gottlieb Daimler, Robert Bosch und Henry Ford. Wesentliche Aufgabe der Transformation ist der Umstieg von konventionellen Antrieben der Verbrennungsmotoren auf elektrische Fahrzeuge und Wasserstoffantrieb – und das in atemberaubender Geschwindigkeit. In Deutschland stellen annähernd eine halbe Million Personen Produkte her, die direkt mit der Verbrennertechnik zusammenhängen (Dieselmotoren, Abgasreinigungssystem oder Auspufftöpfe zum Beispiel). Nimmt man die indirekt vom Auto abhängigen Beschäftigten hinzu, sind es 2,75 Millionen Menschen. Rund fünfzig Prozent der europäischen Wertschöpfung im Kraftfahrzeugbau findet in Deutschland statt. Was wird aus diesen Beschäftigten im Transformationsprozess?
Was Linkedin so alles verrät
Das Ifo-Institut in München hat dazu gerade eine aufregende Studie veröffentlicht – nicht nur wegen ihres Ergebnisses, sondern, wie ich finde, auch wegen der dort angewandten Methode. Die Ausgangsfrage war, welche Kompetenzen bei der Fertigung von Autos künftig gebraucht werden. Und ob die heute schon in der Branche Beschäftigten diese Kompetenzen sich aneignen werden oder ob dazu Personal von außen gesucht werden muss. Es braucht im Zeitalter der Elektromobilität nämlich nicht nur neue Berufe, sondern es ändern sich auch die Berufe selbst, das heißt die ausgeübten Tätigkeiten und geförderten Kompetenzen. So bleibt beispielsweise die Berufsbezeichnung Entwicklungsingenieur bestehen. Doch der muss sich jetzt mit Batteriesteuerungen auskennen.
Um herauszufinden, wie gut oder schlecht die deutsche Industrie für die Transformation gerüstet ist, haben sich die Ifo-Forscher der Daten des beruflichen Netzwerkes LinkedIn bedient. Das ist ziemlich pfiffig. Wer bei LinkedIn Mitglied ist, gibt in der Regel mehr oder weniger detailliert ein berufliches Profil von sich und von seinen professionellen Kompetenzen preis. Damit, so das Ifo-Institut, sei es möglich, die Veränderung der Kompetenzen in der deutschen und internationalen Automobilindustrie sehr zeitnah zu analysieren, besser als mit der nachhinkenden amtlichen Statistik der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Allerdings scheinen die Forscher davon auszugehen, dass die LinkedIn-Community ehrlich ist. Sie unterschlagen dabei die menschliche Neigung, die eigenen Kompetenzen in ein besonders gutes Licht zu stellen. Sei’s drum.
»Emerging Jobs« nennen die Forscher Jobs, die das größte Wachstum innerhalb einer Branche oder Region erwarten lassen. Hier liefern die Daten von LinkedIn erfreuliche Resultate: Sowohl in Deutschland wie auch global ist in letzter Zeit vor allem die Zahl solcher Jobs gewachsen, die mit der Digitalisierung in Verbindung stehen (Software und Entwicklung, Daten und deren Analyse). In Deutschland haben diese Jobs sogar überdurchschnittlich zugenommen. Hier gibt es auch besonders viele neue Tätigkeiten im Bereich von Verwaltung und Personal, klingt langweilig, ist aber für Transformationsprozesse unabdingbar. Allerdings wird schnell deutlich, dass die meisten dieser »Emerging Jobs« von Beschäftigten ausgeübt werden, die neu in der Branche sind. Im Vergleich zu den langjährig in der Autoindustrie Beschäftigten bringen die neu in die Branche gewechselten Menschen 71 Prozent häufiger digitale Kompetenzen mit.Sofern man den Zwischenstand der Ifo-Forscher generalisieren darf, ist die Botschaft einigermaßen beruhigend: Es gibt keinen Grund für Apokalyptik. Die Transformation hierzulande ist in vollem Gang. Und auf gutem Weg. Gewinner sind die neu in die Branche kommenden Beschäftigten. Verlierer sind die Altgedienten, denen die Umstellung schwerfällt. Trägheit war immer schon ein Hindernis der Innovation; dem Strukturwandel sind Neulinge besser gewachsen.
Ein Blick auf Karl Polanyi
Der Befund könnte die bisherigen Erfahrungen mit disruptiven Transformationsprozessen in der Wirtschaftsgeschichte bestätigen. Als »große Transformation« bezeichnet man seit den Arbeiten des Wirtschaftshistorikers und Sozialforschers Karl Polanyi (1886 bis 1946) die Verselbständigung und Entfesselung der Marktprozesse zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Polanyi bewertet diese Erfahrung der »Entbettung« von Wirtschaft und Gesellschaft negativ. Das frrühe 19. Jahrhundert markiert zugleich aber den Beginn der industriellen Revolution, die den ehemals armen Bevölkerungsschichten Wohlstand gebracht hat. Das unterschlägt Polanyi.
Hinzu kommt: Regelmäßig sind wirtschaftliche Transformationsprozesse verbunden mit der Angst vor hoher Arbeitslosigkeit. Doch noch nie sind diese Befürchtungen eingetreten. Prozesse der Automatisierung und Roboterisierung politisch verzögern zu wollen (etwa durch eine Maschinensteuer), rettet keine Arbeit, sondern zerstört sie, wie man beim Ökonomen Philippe Aghion nachlesen kann, dessen neues Buch über die »Kreative Zerstörung« ich nicht genug preisen kann. Technische Revolutionen entfalten ihre Wachstumseffekte stets mit einer Zeitverzögerung: So war es bei der Elektrizität, die von Thomas Edison und Werner von Siemens schon Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde – und ihr enormes Potential erst nach der Jahrhundertwende 1900 ausspielte. Ähnlich könnte es jetzt auch mit der Computerisierung und Digitalisierung vor sich gehen. Niemand muss sich vor technologischen Revolutionen und den wirtschaftlichen Transformationen fürchten, lese ich bei Aghion. Eine beruhigende Botschaft.
Rainer Hank
06. September 2021
Grüner wird's nicht
Nachhaltigkeit, Großspurigkeit, Schlampigkeit
Auf einer Anhöhe südlich von Weimar liegt inmitten eines weitläufigen Parks das Schloss Belvedere, die barocke Sommerresidenz der Familie von Sachsen-Weimar und Eisenach. Das Prunkstück dieser wunderschönen Anlage ist eine Orangerie.
Orangerie – so nennt man historisch repräsentative Gärten für Zitruspflanzen, aber auch die Gewächshäuser, in denen diese Pflanzen die kalte Jahreszeit verbringen. Dass der Wechsel zwischen draußen und drinnen möglich wurde, verdanken wir dem Pflanzenkübel, einer in ihrer Nachhaltigkeit gewaltig unterschätzten menschlichen Erfindung, die auf André Le Nôtre (1613 bis 1700), den Stargärtner von Versailles zurückgeht.
Hunderte Bitterorangenbäume zählten in den besten Zeiten zum Bestand der Orangerie des Weimarer Belvedere. Sie waren Ausdruck einer Hoffnung auf die Wiederkehr des goldenen Zeitalters, sichtbar im Symbol der immergrünen – gleichzeitig Früchte und Blüten tragenden – Zitruspflanzen. Auch Granatäpfel, Feigen und Kaffeebäume seien hier kultiviert worden, so sagt man uns.
Das alles diente dazu, Bedeutung und Reichtum eines barocken Hofes sichtbar werden zu lassen. Und es war ein Ort der Wissenschaft. Bereits der Schlossherr Herzog Karl August von Sachsen-Weimar (1757 bis 1828) gab große Summen für exotische Pflanzen aus. Der Herzog und sein Starminister Johann Wolfgang von Goethe gingen hier ihren botanischen Leidenschaften nach, und so gelangten Exoten aus aller Welt in die Pflanzensammlung eines deutschen Kleinstaates. Besonders berühmt war Belvedere für die Sammlung von sogenannten Kap-Pflanzen und Neuholländern, also Pflanzen aus Südafrika und Australien. Ein besonders gelungenes Beispiel botanischer Globalisierung, wenn man so will.
Thüringen: Das Land, wo die Zitronen blühen
Als wir am vergangenen Wochenende nicht nur, aber auch aus Anlass von Goethes Geburtstag mit Freunden wieder einmal durch die Weimarer Orangerie flanierten, fiel uns auf, dass der Wintergarten selbstverständlich beheizt war. Von Anfang an wurden solche Räume mit mehreren Eisenöfen ausgestattet. Anders hätten die mediterranen und exotischen Pflanzen des Südens das raue Klima Thüringens gar nicht überlebt.
Kurzum: So eine Orangerie schien uns ein vorzügliches Beispiel dafür zu sein, wie sich Pflanzen auch in geographischen Räumen hegen und schützen lassen, die nichts mit ihrer klimatischen Herkunft gemein haben. Sollte ich künftig nach einem Vorbild für eine gelungene Anpassung an den Klimawandel gefragt werden, ich würde von den Orangerien des barocken Zeitalters schwärmen und den Ideenreichtum der damals herrschenden Aristokratie und ihrer wissenschaftlichen Berater preisen. Hier zeigt sich sehr konkret, dass menschliche Kreativität und technischer Erfindergeist zusammenbringen können, was von Natur aus gar nicht zusammengehört: Südfrüchte im Norden.
Die Moral von der Geschichte der Zitrusfrüchte: Wir müssen nicht warten, bis der Klimawandel unseren Planeten zerstört. Wir können uns auch – pro-aktiv wie man heute zu sagen pflegt – ihm entgegenstemmen. Anpassung schlägt Apokalypse.Die Chance eines Lobes technischer Klimaanpassung, so hoffte ich, würde sich auch die Klassik Stiftung Weimer, die die Orangerie bewirtschaftet, nicht entgehen lassen: »Klimawandel in historischen Gärten«, so ist sogar ein laufendes Ausstellungsprojekt benannt, das Teil des Themenjahres 2021 »Neue Natur« ist. Umso enttäuschender gerät dann allerdings die Ausführung: Beredtes Klagen darüber, dass auch die Bäume und Pflanzen der barocken Gärten unter der Erderwärmung zu leiden haben. »Hitze, Dürre, Krankheiten. Wenn ich zehn Jahre in die Zukunft denke, wird mir angst und bange«, klagt Jörg Edel, seines Zeichens Baumkontrolleur in den Weimarer Parks. So sehr ich den Mann verstehe: Meine Überraschung über diese Erkenntnis hält sich in Grenzen. Zu erwägen, künftig in den Parks Bäume und Sträucher zu pflanzen, die die wärmeren Temperaturen besser vertragen, wird als unbrauchbarer Einfall von Kulturbanausen komplett verworfen. Gewiss, die historische Gestalt der Parks entspricht dann nicht mehr im Detail den Ideen des 18. Jahrhunderts. Doch wer Anpassung verweigert, darf sich über den Verfall nicht beklagen.
Origineller als zu klagen und zu weinen wäre es zu bewundern, dass der »Nutzen der Historie für das Leben« in Weimar in der Anschauung der Anpassungsmöglichkeiten an veränderte Umweltbedingungen besteht. Das freilich wäre nicht im Sinn der aktivistischen Präsidentin der Stiftung Weimarer Klassik, Ulrike Lorenz. Sie will künftig »mehr Haltung« zeigen und in die »Gesellschaft von heute« wirken. Womit? Natürlich mit »Nachhaltigkeit«. Das nennt sie eine »Diskurswende«, die doch am Ende schlicht darauf hinausläuft zu machen, was alle machen: Relevanz, Partizipation (»Volksnähe« hätte man früher gesagt), Demokratisierung. Ein MeToo-Projekt (im Vor-Harvey-Weinsteinschen Sinn): Nachäffen ohne jegliche Originalität. Das einzigartige Potential Weimars wird verspielt. Der »Geist der Zeiten« ist bekanntlich allemal »der Damen und Herren eigener Geist«: Es darf vermutet werden, dass diese gedankenarme Zeitgeisterei im Sinne der tonangebenden rot-rot-grünen Thüringer Landesregierung ist. Es darf auch vermutet werden, dass man mit dieser Beflissenheit leichter an öffentliche Fördermittel kommt als mit Widerborstigkeit gegen das, was alle machen.
Der Geist der Zeit ist allemal der Zeitgeist
Ohne Nachhaltigkeit geht gar nichts. Was das konkret ist, ist egal. Weimar macht nichts anderes als die Fondsgesellschaft DWS, die alle ihre Investments zur Geldanlage dem ESG-Gedanken unterstellt: »Environment, Social, Government«. Man habe »einen einzigartigen Ansatz von Nachhaltigkeitsaspekten« gefunden, tönt der Fonds, der den Menschen einen »nachhaltigen Lebensstil« verordnen will. Doch was ist nachhaltig? Atomkraft gewiss – denn ein geringerer Ausstoß von CO2 bei der Produktion von Energie, noch dazu effizient, lässt sich kaum finden. Doch Atomkraft nachthaltig zu nennen, wäre politisch unkorrekt. Nachhaltigkeit ist eine ideologische Chiffre für erhofften Marketingerfolg (einerlei, ob Goethe oder Geldanlage), die mit Klimaschutz nur noch wenig zu tun hat. »Viel Bluff« attestierte die amerikanische Börsenaufsicht SEC kürzlich den DWS-Fonds-Managern. Vielleicht sollte die Behörde sich auch einmal die Nachhaltigkeitsprosa der Klassik Stiftung Weimar vorknöpfen?
Auf den Kommentarspalten des Blogs der Klassik Stiftung findet sich, allerliebst, ein kleines Klimagedicht, in dem es heißt: »Der Handel mit Emissionen/Wird unser Klima nicht schonen/Weg vom ewigen Wachstumswahn/braucht es einen weltweiten Plan/Für den Planeten, die Menschheit/ Gehen wir es an, es ist an der Zeit.« Schöner hätten auch die planwirtschaftlichen Poeten der DDR nicht dichten können. Das »Erbe«, wie man in der DDR gesagt hätte, bleibt auf der Strecke. Wer nur den Zeitgeist nachäfft, dem haben auch Goethes naturwissenschaftliche Schriften nichts mehr zu sagen.
Rainer Hank
