Hanks Welt
Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).
Aktuelle Einträge
25. Juni 2025Vom New Deal zum Real Deal
08. Juni 2025Geld her!
27. Mai 2025Wer stoppt Trump?
10. Mai 2025Ein Herz aus Stammzellen
14. April 2025Lauter Opportunisten
07. April 2025Die Ordnung der Liebe
29. März 2025Streicht das Elterngeld
17. März 2025Der Kündigungsagent
17. März 2025Hart arbeiten, früh aufstehen
04. März 2025Kriegswirtschaft
17. Februar 2021
Neoliberalismus ist des Teufels
Am besten geht es mit Pappkameraden
Es ist kalt geworden in unserer Welt; die Menschen sind unglücklich und einsam. Nein, ich spreche nicht von den Erfahrungen des Zweiten Lockdown. Sondern wissenschaftliche Ergebnisse von einer aktuellen Untersuchung von Sozialpsychologen der Universität Osnabrück, die herausfinden wollten, was der Neoliberalismus den Menschen antut. Und nach Lektüre ihres Papers muss man sagen: Ziemlich viel Schreckliches.
Der Neoliberalismus. Seit ich Wirtschaftsjournalist bin, und das bin ich schon ziemlich lange, ist der Neoliberalismus der Gottseibeiuns, wird auf der Liste der üblichen Verdächtigen immer an erster Stelle genannt, wenn für irgendein Unglück oder eine Ungerechtigkeit ein Bösewicht gesucht wird. Im Mittelalter war das eben Gottseibeiuns, ein Synonym für den Teufel, dessen Namen auszusprechen verboten war, es sei denn, man wollte sich gleich der Hölle ausliefern. Heute würden junge Satirikerinnen wie Ella Carina Werner (»Der Untergang des Abendkleides«) die Neoliberalen am liebsten »verbal massakrieren«. Klingt auf jeden Fall schlimmer als Skalpieren im Indianerspiel meiner Kindheit. Ähnlich wie beim Teufel ist unklar, ob es die Neoliberalen überhaupt gibt. Die Existenz-Frage freilich ist unerheblich für ihre Funktion als Bösewichte vom Dienst. Fast hat man den Eindruck, dass sich einem nicht existenten Neoliberalismus noch mehr anhängen lässt als einem real existierenden Wirtschaftssystem.
Das alles lässt sich idealtypisch an der Osnabrücker Einsamkeits-Studie zeigen. Die Autoren wollten wissen, wann Menschen sich unglücklich und einsam fühlen. Und ob das etwas mit der wirtschaftlichen Verfassung einer Gesellschaft zu tun hat. Dazu legten sie ihren Probanden Aussagen darüber vor, wie eine »neoliberalen« Welt »empfunden« werde: die Märke entfalten sich ungezügelt, der Staat kontrolliert die Unternehmen kaum, der Einzelne ist seines Glückes Schmied und soziale Ungleichheit ist ein positiver Wert,
Anschließend wurden die Versuchspersonen gefragt, wie sie sich in einer solchen neoliberalen Welt fühlen. Ziemlich elend, so die Antwort. Der Wettbewerbsdruck bereitet ihnen Stress, lässt das gute Gefühl sozialer Zusammengehörigkeit vermissen und verstärkt das Gefühl der Einsamkeit. Kurzum: Neoliberalismus ist eine »Gefahr für die Gesundheit der Menschen«. Sein Versprechen, die Menschen frei und selbständig zu machen, könne dieser Neoliberalismus nicht einlösen. Selbst Menschen, die von ihrem sozialen Status her profitieren, wollten nach eigenem Bekunden in einer solchen kalten Welt nicht leben. Denn Leistungsdruck führt, klar doch, zu Burnout.
Es kommt raus, was man reingegeben hat
Das alles findet sich wohlgemerkt nicht in einer antikapitalistisch-esoterischen Nischenpublikation, sondern im »British Journal of Social Psychology« (2021), der wissenschaftlichen Zeitschrift der Britischen Psychologischen Gesellschaft. Und es ist auch nur das letzte Beispiel einer Reihe ähnlicher Untersuchungen, die nachzuweisen suchen, dass der Neoliberalismus krank macht, Ungleichheit unglücklich macht und am Ende auch die Leistungsbereitschaft der Menschen bremse und das wirtschaftliche Wachstum drossele.
Untersuchungen solcher Art funktionieren stets nach dem Motto: Man kriegt hinten raus, was man vorne rein gibt. Neoliberalismus wird als »Ideologie« präsentiert, destilliert aus der anti-liberalen Literatur. Damit steht das Ergebnis am Anfang schon fest. Einsamkeit und Wohlbefinden sind abhängig vom Gesellschaftssystem. Der Neoliberalismus kann keine sozial gerechte Gesellschaft bieten. Dafür gibt es Brief und Siegel akademischer Psychologen, die gar nicht mitbekommen haben, dass man sich über den Neoliberalismus auch aus den Original-Quellen schlau machen kann, nicht nur bei Gegnern wie Piketty & Mirowski.
Mit Empirie, nebenbei bemerkt, hat diese sich selbst erfüllende Wissenschaft nichts zu tun. Ein bisschen Empirie brächte schon ein Blick in die einschlägigen seriösen Rankings zu Ungleichheit, Glücksempfinden und wirtschaftlicher Freiheit. Auf den ersten Plätzen freier Gesellschaften (also im herrschenden Sprachgebrauch »neoliberal«) finden sich Neuseeland, die Schweiz und Dänemark. Genau diese Länder rangieren auch auf den vorderen Plätzen von Ländern, in denen die Bürger zufrieden und glücklich sind. In Deutschland (wirtschaftliche Freiheit Platz 27, also nicht besonders »neoliberal«) sind die Menschen auch nicht übermäßig glücklich (Platz 17).
Würde, wie die Psychologen meinen, das Glück der Menschen in Ländern großer sozialer Gleichheit besonders positiv blühen, müsste dies sich in den Rankings spiegeln. Egalitäre Länder (gemessen am sogenannten Gini-Koeffizienten) sind zum Beispiel die Ukraine oder Slowenien. Dort, aber auch in Usbekistan, lebt es sich deutlich egalitärer als in Deutschland. Gleichwohl würden die Probanden der Psychologen (sie stammen aus Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten) wohl ungern nach Usbekistan emigrieren in der Hoffnung, dort weniger einsam und krank zu werden.Hayek und Eucken lesen hilft
Dass man kritisch und fair mit dem Neoliberalismus umgehen kann, zeigt eine gerade bei Suhrkamp unter dem Titel »Die politische Theorie des Neoliberalismus« erschienene Studie des Politikwissenschaftlers Thomas Biebricher. Die Instrumentalisierung des Neoliberalismus als »polemisches Instrument politischer Diffamierungskampagnen« findet Biebricher wenig anschlussfähig. Kein Wunder, dass fast nur die Gegner sich des Begriffs bedienen. Wer heute von sich selbst sagt, er sei ein Neoliberaler, hat sich aus dem Diskurs herausgeschossen und dem Shitstorm preisgegeben.
Biebricher, wie gesagt kein neoliberaler Apologet, zeigt anhand der Quellen (Hayek, Eucken, Röpke, Buchanan) welche Klischees über den Neoliberalismus in Umlauf sind. Seit seiner Gründung in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts vertrat der Neoliberalismus die Auffassung, der Glaube an sich selbst regulierende Märkte (»Laissez-Faire«) sei ein Irrweg, von dem man sich verabschieden müsse. Also das exakte Gegenteil dessen, was ihm heute notorisch unterstellt wird. Man war stets gegen und nicht für einen Marktfundamentalismus, wollte keinen schwachen, sondern einen starken Staat, der wirtschaftliche Macht kontrolliert und Wettbewerb autoritär durchsetzt. Biebricher im O-Ton: »In gewisser Weise ist es gerade der Markt, der zum Problem für die Neoliberalen wird. Denn angesichts von Niedergang und Krise des Liberalismus ist es schlicht keine haltbare Position mehr, den ehernen Gesetzen des Ökonomischen dabei zuzusehen, wie sie die Dinge automatisch und ganz von selbst regeln.«
Es wäre schon viel gewonnen, wenn die Gegner des Neoliberalismus künftig nicht ihre selbst geschaffenen ideologischen Zerrbilder zur Grundlage von Kritik nähmen. Es lohnt sich allemal mehr, eine Position an ihrem Selbstverständnis und bei ihren stärksten Seiten zu packen, als sich Pappkameraden zu basteln. Aber natürlich ist es lustvoller und zugleich weniger anstrengend, Pappkameraden abzuschießen. Zumal die Mehrheit der Kritiker dasselbe Pappkameraden-Spiel spielt – so fühlt man sich dann in der besten, die antikapitalistische Seele wärmenden Gesellschaft weniger einsam und weniger unglücklich.
Rainer Hank
10. Februar 2021
Und vergib uns unsere Schulden
Mit Corona lässt sich viel Schindluder treiben
Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, im Dezember 1944, erschien in der angesehenen Zeitschrift »The American Economic Review« ein Aufsatz des Wirtschaftswissenschaftlers Evsey D. Domar. Der Artikel trug den Titel »Die Last der Schulden«. Im Krieg waren Staatsschulden Amerikas auf über hundert Prozent des Bruttosozialprodukts gestiegen; kurz vorher lagen sie noch bei knapp zwanzig Prozent. Grund genug zu fragen, wie solche Lasten je wieder abgetragen werden können.
Domar war damals dreißig Jahre alt und Mitarbeiter der amerikanischen Notenbank Fed. Mit seinem Aufsatz fand er mit einem Schlag öffentliche Bekanntheit. Domar konnte eine typische Immigrantenbiografie des 20. Jahrhunderts erzählen. Geboren im Jahr 1914 im polnischen Lodsch hatte er seine Jugend in der Äußeren Mandschurei in Russland verbracht. 1936 wanderte er in die Vereinigten Staaten aus, studierte an der Universität von Kalifornien in Los Angeles Ökonomie, bevor er 1947 an der Harvard Universität promoviert wurde. Als Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT) profilierte er sich als einer der ersten Keynesianer und als Wirtschaftsexperte für die Sowjetunion.
Die Zeit unmittelbar nach dem Krieg, so die Prognose Domars, sei noch das geringste Problem für die Staatsverschuldung. Der Wiederaufbau würde Amerika einen Wachstumsboom und den Menschen Vollbeschäftigung bescheren. In dieser Zeit könnten öffentliche Defizite rasch durch Überschüsse der privaten Wirtschaft finanziert werden. Doch das halte nicht dauerhaft: Dann aber stellt sich die Frage, wann und unter welchen Bedingungen Staatsschulden »tragfähig« sind.
Das Zauberwort: Schuldentragfähigkeit
»Schuldentragfähigkeit« heißt bis heute das Zauberwort der Finanzwissenschaft, das man umgangssprachlich mit »können wir uns leisten« übersetzen könnte. Das ist nicht ganz trivial, setzt es doch voraus, dass Staatsschulden per se nicht schlecht sind, solange sie einem langfristig nicht über den Kopf wachsen.
Interessant sind Domars Annahmen darüber, wie sich wohl die Verschuldung der Vereinigten Staaten mittelfristig entwickeln werde. Realistisch sei ein eher dunkles Bild, schreibt er. Danach würden sich jeweils 25 Jahren Frieden mit fünf Jahren Krieg abwechseln. Damit lag der Wissenschaftler natürlich komplett daneben (so viel zur Prognosekraft der Wirtschaftswissenschaft). Doch man sieht sofort, wie Domar zu seiner Annahme kommt: Genau fünfundzwanzig Jahre liegen zwischen dem Beginn des Ersten und des Zweiten Weltkriegs; beide Kriege dauerten etwa fünf Jahre. Domar befürchtete offenbar, das Muster werde sich wiederholen.
Weltkriege gab es seither zum Glück keine mehr. Doch niemand hat verraten, dass hundert Jahre nach der Spanischen Grippe uns abermals eine weltumspannende Pandemie ereilt. Für die Friedenszeiten beziffert Domar die staatlichen Defizite auf jährlich sechs Prozent, während die Kriegswirtschaft einen Verschuldungsbedarf von 50 Prozent habe. Unter diesen Annahmen würden sich die Schulden bald so rasch vermehren wie das Wirtschaftswachstum: Grund zur Sorge.
Domar nennt für die Schuldentragfähigkeit vier Bestimmungsgrößen: (1) die Defizitquote, welche neue Schulden in Bezug zur Wirtschaftsleistung eines Landes setzt, (2) die gesamte Schuldenquote, (3) die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und schließlich (4) den Zinssatz. Das hat bis heute Bestand. Wichtig zu sehen ist dabei, dass die einzelnen Bestimmungsgrößen nicht unabhängig voneinander sind: Steigende Schulden können zu höheren Zinsen führen, was negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und auf die Staatsausgaben hat, die vom Schuldendienst aufgefressen werden.
Hätte man Domars Sorgen ernst genommen, hätte es nahegelegen, schon früher eine Schuldenbremse in die Verfassungen zu schreiben. Seit der Nachkriegszeit sind die Schulden nahezu aller Länder gestiegen, in Deutschland von knapp zwanzig Prozent in den fünfziger Jahren auf über achtzig Prozent nach der Jahrtausendwende. Mit Einführung der Schuldenbremse wurde der Bann gebrochen. Die »Last der Schulden« verringerte sich bis zum Jahr 2019, also vor Corona, auf knapp sechzig Prozent der Wirtschaftsleistung, womit sie wieder im Einklang waren mit den Anforderungen des Maastricht-Vertrags.
Corona verdirbt die Sitten
Der Clou der Schuldenbremse besteht darin, dass sie der Politik die willkürliche Verfügungsmacht über die Staatsverschuldung entzieht und sie an Regeln bindet, die, da in der Verfassung verankert, von jeder Regierung befolgt werden müssen. Das Prinzip ist wichtiger als die konkrete Ausgestaltung. Derzeit ist ein jährliches Defizit erlaubt von 0,35 Prozent des BIP. Etwas raffinierter wäre es, die Begrenzung der Neuverschuldung an steigende Zinsen zu binden, wie es der Ökonom Carl Christian von Weizsäcker vorschlägt: Je höher der Zins, umso geringer die erlaubte Neuverschuldung. Denn sonst ist es um die Tragfähigkeit der Schulden rasch geschehen; Staatspleiten drohen. Gottgegeben sind niedrige Zins-Wachstums-Verhältnisse nämlich nicht: Historisch folgten auf Phasen negativer Zins-Wachstums-Differenzen Zeiträume, in denen die Zinsen deutlich über dem realen BIP-Wachstum lagen.
Das alles klingt plausibel und war auch bis vor kurzem vielfach Konsens. Doch richtig gepasst hat der Politik die Schuldenfessel noch nie. Mit Schulden können sie, anders als mit höheren Steuern, den Bürgern Wohltaten bescheren, ohne dass es weh tut. Blumig sprechen sie von einer »Entlastung« für die Zukunft. »Wir dürfen die Erde nicht tot sparen«, heißt eine meiner Lieblingsformulierungen von Umweltministerin Svenja Schulze. Auch viele Ökonomen plädieren inzwischen für ein Zurück zur sogenannten »Goldenen Regel«, die qua Verfassung früher einzuhalten war: Erlaubt war das Schuldenmachen für Investitionen, die einen Nutzen für künftige Generationen haben. Ein ziemlicher Gummiparagraf: Was Investitionen sind, ist nebulös: Der Bau von Straßen gilt als Investition (auch wenn es die Brücke ins Niemandsland ist). Die Finanzierung von Schulunterricht dagegen fällt unter die Kategorie »Konsum«.
Zwar will immer noch die Mehrheit der deutschen Finanzwissenschaftler an der Schuldenbremse festhalten, wie die Sonntagszeitung vergangene Woche erfragt hat. Doch die Gegner finden immer mehr Gehör bei der Politik. Jetzt bietet es sich an, mit der Keule Corona die Schuldenbremse aus der Verfassung zu verbannen. Dass diese Meinung inzwischen auch im Kanzleramt vertreten wird, quasi als Morgengabe für die Koalition der Union mit den Grünen, ist beunruhigend. Übersehen wird dabei der Umstand, dass es gerade ein Erfolg der Schuldenbremse war, dass Deutschland fiskalisch während Corona so stark dasteht.
Corona verdirbt die Sitten. Wenn es ernst wird, ändert man die Regeln, die doch gerade für den Ernstfall gedacht waren. Und wenn es noch standhafte Ökonomen gibt, wie Lars Feld, den Vorsitzenden des Sachverständigenrats, der die Schuldenbremse mannhaft verteidigt, dann droht man solch unabhängigen Beratern mit seiner Entlassung, betrieben von der SPD und schein-unschuldig von der Union beobachtet. Dass die Partei Ludwig Erhards bereit ist, einen Ökonomen wie Lars Feld, weil »zu liberal«, in die Wüste zu schicken, kann man einfach nur schäbig nennen.
Rainer Hank
04. Februar 2021
Freiheit in der Pandemie (II)
Wider die Corona-Müdigkeit: Jetzt muss sich zeigen, was Freiheit konkret bedeutet
Die Zeitdiagnostiker beschreiben die aktuelle Phase der Pandemie als »Corona-Fatigue«. Man kann es mit »coronamatt« übersetzen. Im Unterschied dazu erinnern wir die erste Phase im Frühjahr 2020 als »coronaängstlich«. Das ist ein riesengroßer Unterschied: Damals standen wir unter Schock, wollten alle staatlichen Anordnungen brav befolgen und wurden – scheinbar – damit belohnt, dass im Sommer alles gut sein werde. Heute ist die Angst vor Ansteckung angesichts eines Gewöhnungseffekts zurückgegangen. Doch trotz großer Anstrengungen nun schon seit November gibt es keine Erfolgserlebnisse. Mehr noch: Den immer strenger werdenden Mitteln rutschen die Ziele weg. Zwar gehen die Infektionszahlen zurück, aber wir kriegen keine Belohnung dafür. Denn jetzt lugt ja gefährlich die Mutante um die Ecke. Man mag den Mechanismus von Zuckerbrot und Peitsche als kindlich-archaisch beschreiben: Doch er wirkt eben auch bei erwachsenen Leuten. Oder anders gesagt: ist der Anreizmechanismus außer Kraft gesetzt, stellt sich Corona-Mattigkeit ein.
Angesichts der Zermürbung ist es wichtig, dass eine liberale Gesellschaft nicht alle Prinzipien über Bord wirft. Freiheit ist nicht (nur) etwas für Schönwetterzeiten, sondern hat immer Vorfahrt. Wer jetzt von Zero-Covid träumt und alles Leben abschalten will, hat mit der Freiheit gebrochen. Man sagt uns, wir müssten erst mit radikalen Maßnahmen die Freiheit einschränken, damit möglichst niemand krank wird. Wenn das dann wirkt, könnten wir auch wieder über die Freiheit reden. Der gute Zweck – »Bleibt alle gesund« – rechtfertigt im Ausnahmezustand alle Mittel. Das kommt davon, dass wir offenbar immer noch sehr im Dunkeln tappen bei der Frage, wo sich eigentlich die Menschen infizieren. Das Totschlagargument der Freiheitsgegner lautet: Wenn ihr hinterher an oder mit Corona gestorben seid, nützt euch die Freiheit auch nichts mehr.
Wo bleibt die Verhältnismäßigkeit?
Verhältnismäßig ist das alles schon lange nicht mehr, wie Uwe Volkmann, ein in Frankfurt lehrender Professor für Öffentliches Recht, jüngst in der hier in der F.A.Z. geschrieben hat. Verhältnismäßig heißt, die Maßnahmen müssen »geeignet, erforderlich und angemessen sein«. Oder umgangssprachlich: Man soll nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Die Freiheit des Einzelnen ist in einem liberalen Land unbegrenzt, solange sie nicht die Freiheit anderer mindert. Die Macht des Rechtsstaates ist dagegen prinzipiell begrenzt. Begründungspflichtig ist der staatliche Eingriff als Ausnahme, nicht die als Regel gesetzte individuelle Freiheit. Dieses Verhältnis von Ausnahme und Regel dient im freiheitsrechtlichen Kontext als Korrektiv, das verhindert, dass die staatliche Befugnis zur Begrenzung der Freiheitsrechte die individuelle Freiheit zu weit zurückdrängt.
Die Rhetorik der Regierung führt zwar stets die Verhältnismäßigkeit im Munde. Aber nur um zu kaschieren, dass man in Wirklichkeit mit Kanonen auf alles schießt, was sich bewegt, weil man gar nicht weiß, wo die Spatzen sitzen. Fragen der Eignung (bringt das etwas?) und der Erforderlichkeit (geht es nicht auch ein paar Nummern kleiner?), fallen unter den Tisch, moniert Uwe Volkmann. Vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bleibt dann nur noch eine ganz abstrakte Abwägung zwischen den verfolgten Zwecken (Schutz der Bevölkerung, Belastung der Kliniken) und der von ihr ausgehenden Beeinträchtigung (im Vergleich zum Zweck ist das immer akzeptabel).
Deswegen ist die Frage, wie wir in der Gesellschaft mit den gegen Corona geimpften Mitbürgern umgehen alles andere als eine Petitesse. Wer geimpft ist, sollte so schnell wie möglich in die Freiheit entlassen werden. Alles andere widerspricht den Kriterien der Verhältnismäßigkeit. Für sie muss Normalität herrschen. Sie arbeiten, reisen, gehen ins Restaurant und in die Oper. Der ökonomische Nebeneffekt: Wirtschaft und Gesellschaft kommen aus dem Stillstand heraus. Der psychologische Nebeneffekt: Freiheit wird für jedermann konkret erlebbar als eine Erzählung der Hoffnung.Die These »Vorfahrt für Geimpfte«, die ich am vergangenen Sonntag auf diesem Kolumnenplatz argumentiert habe, hat ungewöhnlich viel Resonanz gefunden. Ich will hier auf einige Kritikpunkte eingehen.
Müsste es nicht besser heißen: »Freiheit für alle, die immun sind«? Ja, das wäre in der Tat konsequent. Darunter fallen dann auch die vielen Menschen, die die Krankheit überwunden haben und gesund sind. Und alle, die ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen können. Hundert Prozent sicher ist das alles nicht. Da haben die Kritiker Recht. Aber wenn die Freiheit Vorrang hat, dann sollen Geimpfte so lange frei sich bewegen dürfen, bis belastbar erwiesen ist, dass sie trotz Impfung das Virus weitergeben. Ich bin kein Virologe, sagt man heute gerne. Aber ich habe genügend Aussagen von Mainstream-Virologen gelesen, man brauche sich nach derzeitigem Wissensstand keine Sorgen machen, dass die Impfstoffe gegen Mutanten wirkungslos seien. Allenfalls werde die Wirksamkeit etwas reduziert. Im Sinne der Verhältnismäßigkeit gilt: Wir sperren die Bürger ja auch nicht vom Straßenverkehr aus, obwohl es viele Unfallrisiken gibt.
Wer hätte einen Schaden?
Ist es denn gerecht, Geimpfte in die Freiheit zu entlassen, obwohl noch lange Zeit nicht jeder geimpft wird, der das will? Aus Sicht der noch nicht Geimpften mag sich das ungerecht anfühlen. Aber hätten sie außer innerer Genugtuung einen Vorteil davon, dass die Geimpften so lange im Lockdown bleiben, bis alle geimpft sind? Und hätten sie einen Schaden durch die Freiheitsausübung der bereits Geimpften? Dass sich die große Mehrheit der Bevölkerung und sogar die Mehrheit der Impfwilligen dagegen ausspricht, die Geimpften ins Leben zu entlassen, zeigt, wie sehr die Freiheit inzwischen auf den Hund gekommen ist.
Das alles schließt nicht aus, dass über Priorisierung der Impfung gestritten wird. So ist es immer, wenn der Preismechanismus zur Zuteilung von Gütern außer Kraft gesetzt wird und die Bürokratie Schlange stehen anordnet. Wir wollen aus guten Gründen nicht, dass derjenige zuerst an Impfstoff kommt, der am meisten bezahlt. Doch sollen die Geimpften gefangen gehalten werden, weil hinten noch viele in der Impfschlange warten? Das leuchtet mir nicht ein.
Und wie sähe das alles konkret aus? Treu und Glauben werden nicht reichen. Es wird nicht zu vermeiden sein, dass vor dem Betreten eines Restaurants, eines Schuhgeschäfts oder eines Gottesdienstraums der Impfpass, das Testergebnis oder das Genesungs-Zertifikat des Gesundheitsamtes vorzulegen sind. Schön sind Kontrolleure nie. Und natürlich ist nicht auszuschließen, dass der Kneipenbesitzer ein Auge zudrückt. Aber das gilt derzeit generell: Es ist auch anzunehmen, dass der ein oder andere Friseur seine Stammkunden zum Hintereingang reinlässt.
Dass das Freiheitsversprechen Anreize setzt, sich impfen zu lassen und Pharmaindustrie und Staaten unter massiven Druck bringt, ihre Impfstrategie zu forcieren, ist gewollt. Es ist evident, dass die Vorteile des Impfens deren Risiken bei weitem übertreffen. Niemand wird genötigt, sich impfen zu lassen. Solange er eine mögliche Gefahr für die Gesundheit seiner Mitmenschen bedeutet, sind ihm Einschränkungen zuzumuten.
Rainer Hank
27. Januar 2021
Vorfahrt für Geimpfte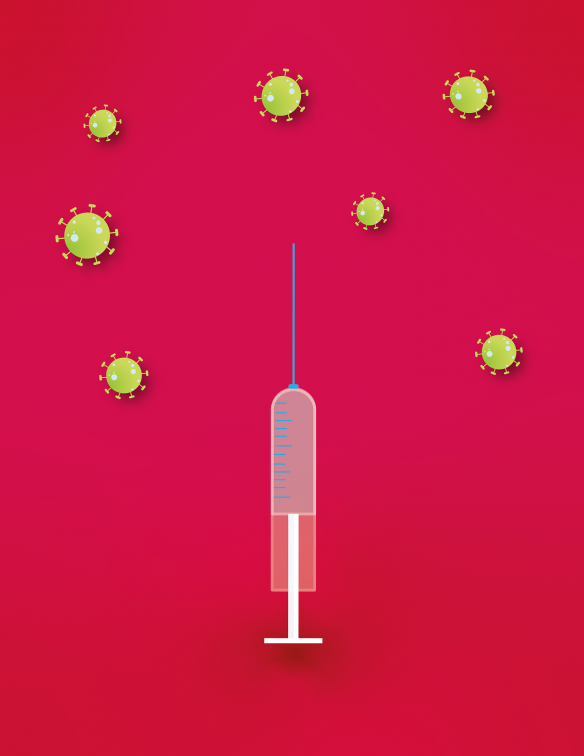
Zwang als Solidarität zu verkaufen geht gar nicht
An ihren Worten könnt ihr sie messen: Es war ein Sozialdemokrat, der Außenminister und Vizekanzler Heiko Maas, der als erster Spitzenpolitiker dafür warb, Bürger, die gegen Corona geimpft wurden, in die Freiheit zu entlassen. Vom neu gewählten Vorsitzenden der CDU, Armin Laschet, war zu diesem Thema nichts dergleichen zu vernehmen. Eine verpasste Chance, finde ich: Laschet hat die Gelegenheit verschenkt, am Start seiner bundespolitischen Karriere konkret zu werden – und zugleich seine Partei einzunorden. In jeder Sonntagsrede betonen CDU-Leute, man sei konservativ, christlich und liberal. Jetzt, wo das liberale Bekenntnis konkret werden könnte, pennt Laschet.
Wäre er gefragt worden, hätte Laschet Maas mutmaßlich entschieden widersprochen und – wie in früheren Interviews – als »obersten Wert« verkündet, es dürfe kein »indirekter Impfzwang ausgeübt« werden. Da zeigt sich ein zutiefst paternalistisches Politikverständnis, dem die Ruhe im Land wichtiger ist als die Freiheit. Aus Angst vor den »Impfgegnern« wird den Geimpften ihre Freiheit vorenthalten. Man sollte hier besser von Diskriminierung der Geimpften statt von Privilegierung reden.
Das Argument für die Freiheit ist nicht kompliziert, hierzulande aber auch nicht sehr beliebt: Freiheit ist in einer liberalen Demokratie der höchste Wert und die logische Voraussetzung aller anderen Werte. Deshalb steht sie auch in der Verfassung an oberster Stelle: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Dieses Recht wird dem Bürger weder vom Staat, noch von sonst jemandem gnädig verliehen. Freiheit ist kein Privileg, sondern Selbstverständlichkeit. Der Bürger hat seine Freiheit quasi immer schon. Der Staat braucht Gründe, wenn er die Freiheit einschränkt.
Schlag nach bei John Stuart Mill!
Ein Geimpfter muss von und vor niemandem geschützt werden. Heiko Maas hat Recht: der Geimpfte nimmt niemandem ein Beatmungsgerät weg. Niemand hat Nachteile. Je schneller die Geimpften wieder in die Kinos, die Restaurants und auf die Skipisten kommen, umso rascher kommen wir auch wirtschaftlich wieder in die Normalität zurück. Doch eher liebäugeln die Politiker mit gesetzlichen Eingriffen in die Vertragsfreiheit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder zwischen Gastwirten und Gästen.
Bleiben wir noch kurz beim Grundsätzlichen und rufen als Gewährsmann den großen englischen Freiheitsphilosophen John Stuart Mill (1806 bis 1863) mit seiner Schrift »On Liberty« in den Zeugenstand: Danach ist Freiheit jene Grenzziehung, die es jedermann (eben erst recht auch dem Staat) verbietet, sich in die Entscheidungen und Handlungen der Bürger einzumischen und ihnen Vorgaben zu machen. Freiheit ist das Recht, zu tun und zu lassen, was ich will. Mill fügt sogleich hinzu, dass dieses Recht dann und nur dann eingeschränkt werden darf, wenn die Freiheit des einen den anderen schädigt. Absolute Freiheit findet ihre Grenze an der Freiheit und dem Recht auf Unversehrtheit des anderen.Wie weit der Respekt vor der Freiheit geht, dafür gibt es bei Mill ein berühmtes Beispiel: Ein Ausländer, der im Begriff ist über eine einsturzgefährdete Brücke zu gehen und die warnenden Rufe der Umstehenden nicht verstehen kann, darf zwar von anderen am Weitergehen gehindert werden – aber nur, damit er sich der Gefahr bewusst wird. Ebenso darf ein Selbstmörder an seiner Tat nur gehindert werden, wenn er offenkundig krank und nicht Herr seiner Sinne ist.
Halten wir also zur künftigen Orientierung im politischen Spektrum fest (man muss jetzt ja schon Strichlisten machen für die Wahl im Herbst): Der christlich-konservativen Union ist die Freiheit egal, der gewöhnlich egalitär argumentierenden Sozialdemokratie nicht. Eine Solidaritätsadresse des Kanzlerkandidaten Olaf Scholz an Heiko Maas wäre freilich dringend nötig. Christian Lindner von der FDP, angeblich auch eine Partei der Freiheit, warnt ähnlich wie Laschet vor einer Zweiklassengesellschaft zwischen Geimpften und Nichtgeimpften. Ein klares Bekenntnis zur Freiheit klingt anders; Warnungen vor Zweiklassengesellschaften kommen in der Regel eher von den Linken. Das Wort »Ausgangs-Sperre«, was im Klartext bedeutet, Bürger in ihre Wohnungen einzusperren, kommt vielen Politikern derzeit flüssiger über die Lippen als das Wort »Freiheit«.
Es gilt das Gebot der Verhältnismäßigkeit
Kommen wir jetzt zu den Gegenargumenten und prüfen sie an Mills Freiheitsverständnis: Freiheitsrechte für die Geimpften bedeuten mitnichten einen Impfzwang durch die Hintertür, also keine Einschränkung der Freiheit anderer. Jedermann ist frei, sich nicht impfen zu lassen, muss aber wie sonst auch die Konsequenzen seiner Freiheitsentscheidung tragen. Weil ein nicht Geimpfter potenziell eine Gefahr für Gesundheit und Leben seiner Mitmenschen darstellt (und vice versa), sind ihm Einschränkungen seines Freiheitsgebrauchs zuzumuten, solange sie sich am Gebot der Verhältnismäßigkeit orientieren. Der Freiheitsgewinn wird ein Anreiz, sich impfen zu lassen. Was spricht gegen Anreize?
Ist es aber womöglich ein Gebot der Solidarität, Geimpfte so zu behandeln wie Nicht-Geimpfte? Solidarität mit den Schwächeren? Was hätte ein Nicht-Geimpfter davon, dass einem geimpften Paar Kaffee und Kuchen in der Konditorei verweigert wird? Nichts, außer einer Befriedigung seines Neidgefühls. Das Solidaritätsargument wird auch nicht besser durch den zusätzlichen Hinweis etwa der Kanzlerin, viele Impfwillige müssten noch lange warten, bis sie dran sind. Viel eher ließe sich diese der Not geschuldete Geduldsprobe als Akt der Solidarität bewerben – den Alten und Kranken und dem Pflegepersonal den Vortritt zu lassen ist solidarisches Handeln, eben weil diese Personengruppen von Corona am stärksten gefährdet sind.
Nun zum Vorwurf der Zweiklassengesellschaft. Das Argument ist triftig, denn dahinter steckt viel Wahrheit: Freiheit schafft Ungleichheit. Das ist unvermeidlich. Wer seine Begabung dazu nutzt, ein berühmter Cellist oder ein erfolgreicher Spekulant zu werden, unterscheidet sich danach von all jenen, die es nicht so weit gebracht haben. Wer es mit der Freiheit ernst meint, muss diese Ungleichheit in Kauf nehmen. Sozialisten, Kommunisten und Urchristen wollen das nicht und geben der Gleichheit den Vorzug.
Schließlich zum Totschlagargument, womöglich würden auch Geimpfte das Virus als Transporteur an Nicht-Geimpfte weitergeben. Da tappen die Weisen offenbar tatsächlich noch im Dunkeln. Doch müsste man nicht vom Standpunkt der Freiheit aus den Spieß umdrehen? Die Beweislast haben jene, die den Geimpften zu einem Gefährder machen. Solange das nicht feststeht, hat er frei seiner Wege zu gehen. Ein Generalverdacht allein reicht zur Freiheitsbeschränkung nicht aus. Zumal im Totschlagargument ein Denkfehler steckt: Der Geimpfte trifft in der Freiheit doch nur auf seinesgleichen: andere Geimpfte oder frisch negativ Getestete. Es kann also wenig schief gehen. Oder wollen wir die Freiheit suspendieren, bis die ganze Menschheit immun ist?
Es ist dringend nötig, die Welt wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Impfen, impfen! Testen, testen! Für alle, die geimpft oder getestet sind, tritt der Normalfall der Freiheit ein: Sie können und sollen mit allen, die getestet und geimpft sind, reisen, musizieren, Autos bauen, Feste feiern.
Rainer Hank
18. Januar 2021
Kommen jetzt die Roaring Twenties?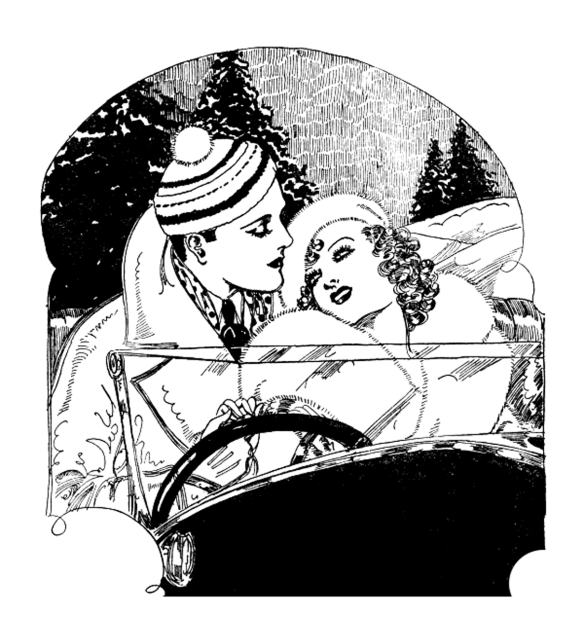
Das wird lustig, wenn Corona endlich vorbei ist
In Zeiten des Lockdowns haben wir viel Muße zu sinnen, wie die Welt aussehen wird, wenn diese Pandemie vorbei ist – oder wenigstens so viele Menschen geimpft sein werden, dass ein normales Leben möglich sein wird. Ich jedenfalls, der ich nie ein großer Fernreisender war, sehe mich mehrere Wochen in Südafrika verbringen und anschließend den Lockrufen derer nachzugeben, die mir immer schon von Neuseeland vorschwärmten. In der Nacht sind meine Träume derart bevölkert, dass ich mir beim Aufwachen große Feste vorstelle mit noch den entferntesten Bekannten. Der Caterer bekommt, meinem schwäbischen Naturell zum Trotz, den Auftrag, richtig in die Vollen zu gehen. Später dann schließen sich mindestens zwei Wochen New York an, wo kein einziger Konsumwunsch unerfüllt bleiben soll. Ein Paradox des Corona-Zeit besteht ja darin, mehr Geld zu haben als wir ausgeben können. Vornehm gesagt: Die Konsummöglichkeiten hinken den verfügbaren Einkommen hinterher.
Höre ich mich bei Freunden um, die bislang nicht dafür bekannt waren, das Geld mit vollen Händen auszugeben, scheint es denen ähnlich zu gehen. »Wir wollen es krachen lassen und mit allen Schikanen essen gehen«, whatsappt eine Berliner Freundin. Es ist, als ob wir uns kollektiv zu einer Art von Belohnungskonsum berechtigt fühlen. Käme es so, hätte die Sause den nicht zu verachtenden Nebeneffekt, dass wir uns um die Konjunktur nach Corona keine Sorgen machen müssten: An unserer aggregierten Nachfrage wird es nicht scheitern. Am Angebot wohl auch nicht, denn anders als nach Kriegszeiten können Fabriken und Geschäfte auf der Stelle hochgefahren werden, wenn der Spuk vorbei ist.
Was spricht dafür, dass wir einen derartigen Boom erleben werden? Hört man sich um, so teilen sich die Prognostiker etwa halb und halb in Pessimisten und Optimisten auf. James Rickards etwa, ein sehr erfolgreicher amerikanischer Untergangsprophet, sieht die Welt auf direktem Weg in eine neue »Große Depression«. Hat er recht, wird uns nichts erspart bleiben: Deflation, Schuldenchaos, Arbeitslosigkeit und demographische Verwerfungen lassen uns in seinen Büchern jetzt schon in Abgründe blicken. Rickards beruft sich auf die renommierte Harvard-Ökonomin Carmen Reinhart, die der Ansicht ist, die Zeit nach Corona werde den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ähneln. Das kann heiter werden.
Reaktion auf die Spanische Grippe
Gottlob finden sich auch Optimisten. Nicholas Christakis, ein an der Universität Yale lehrender Sozialwissenschaftler, deutet die »Roaring Twenties« des 19. und 20. Jahrhundert als eine Reaktion auf die Spanische Grippe 1918 bis 1920. Wer damals erlebt hat, welchen Verzicht kultureller Ausdrucksmöglichkeiten mehrere Lockdowns bedeuten, entwickelte vitale Kräfte, das Leben in vollen Zügen zu spüren. Dem schließt sich Klaus Kaldemorgen an, ein erfahrener Fondsmanager Deutschlands: »In den Goldenen Zwanzigern gab es einen gewaltigen Börsenaufschwung, nachdem die spanische Grippe überwunden war«, sagt er im Gespräch mit der F.A.S.
Alles hängt davon ab, ob wir als Referenzjahr zu heute wie die Pessimisten das Jahr 1930 nehmen oder wie die Optimisten das Jahr 1920. Stehen wir – wirtschaftshistorisch gesehen – vor den Zwanziger- oder den Dreißigerjahren? Wenn mein »Wunschdenken« die Realität bestimmen könnte, wüsste ich, wie es ausgeht. Wer Recht hat, wissen wir erst in zehn Jahren. Aber nach spekulativen Plausibilitäten können wir fahnden.
Nachfrage bei Harold James, einem Professor der Universität Princeton, der viel über die Wirtschafts- und Finanzgeschichte des 20. Jahrhunderts geforscht hat. Harold James outet sich als Optimist. »Wir werden die Segnungen der Globalisierung zurückgewinnen«, mailt er mir und verweist auf seine Forschungen zur Frage, wie sich die Wirtschaft nach sogenannten Angebotsschocks entwickelt hat. Allemal, so das Resultat des Wissenschaftlers, wurde die weltweite Vernetzung der Wirtschaft nach solchen Krisen nicht etwa beschnitten, sondern sogar noch ausgeweitet – mit positiven Auswirkungen für den Wohlstand der Menschen.
Return to Normality
Dieser Wohlstandsgewinn lässt sich an der Dekade zwischen 1920 und 1929 im Detail nachzeichnen. Der amerikanische Politiker Warren G. Harding (1865 bis 1923), ein Republikaner, wurde 1921 zum Präsidenten gewählt mit dem Slogan »Return to Normality«, zurück zur Normalität. Damit traf er offenbar einen Nerv der Zeit, ein optimistisches Grundgefühl eben. Die Wirtschaft entwickelte sich prächtig. Die Amerikaner, bis dahin eher calvinistisch-sparsam, entwickelten große Freude am Geldausgeben und hatten auch keine Scheu, auf Pump zu konsumieren. Henry Ford kam kaum mit der Fließbandfertigung seines T-Modells kaum nach. Waschmaschinen, Kühlschränke, Bügeleisen und Nähmaschinen galten unter den Hausfrauen als der neueste Schrei. Die Erfindung der Werbung sorgte dafür, dass die neuen Produkte auch überall im Land bekannt und als begehrenswert erachtet wurden. Vor dem Krieg hatten sich nur die Reichen Aktien geleistet, jetzt wurde die amerikanische Börse ein Tummelplatz für jedermann. Teure Mode verführte Männer wie Frauen. Das öffentliche Leben blühte überall auf. New York wurde zur Hauptstadt des Jazz (Louis Armstrong, Duke Ellington); Hollywood entwickelte sich zur Welthauptstadt der Filmindustrie. Wer es genauer haben will, braucht bloß »The Great Gatsby«, den 1925 veröffentlichten Roman von F. Scott Fitzgerald zu lesen.
Das Deutschland der zwanziger Jahre war alles in allem nicht ganz so glamourös. Aller heutigen Mythen zum Trotz war Berlin kein Babylon. Autos oder Haushaltsgeräte für jedermann gab es erst im Wirtschaftswunder nach dem zweiten Weltkrieg. Das Wohlstandsgefälle zwischen Amerika und Deutschland war viel größer als heute Aber gleichwohl: Auch Deutschland blühte auf, und das war nicht nur eine Scheinblüte, wie manche Historiker meinen. Schon bald waren Produktion und Einkommen wieder auf das Vorkriegsniveau angestiegen. Massenkonsum und Massenunterhaltung wurden zur Signatur der Zeit; zugleich leisteten es sich die Deutschen, Bismarcks Sozialstaat weiter auszubauen.
Natürlich können die zwanziger Jahre in Deutschland und Amerika nicht zur Blaupause für unsere Zeit übernommen werden. Vor allem fehlen uns heute die in die Massenproduktion eingehenden technischen Innovationen von damals; der zu erwartende Digitalisisierungsschub nach Corona wird das nicht leisten. Aber das optimistische Grundgefühl könnte jener positiven Stimmung von damals ähneln. Stimmungen und Gefühle als Konjunkturtreiber – die berühmten »animal spirits« von John Maynard Keynes – sollte niemand unterschätzen.
Beckmesser werden jetzt daran erinnern, wie die zwanziger Jahre endeten: mit einem schlimmen Börsencrash im Oktober 1929, gefolgt von Schuldendeflation, Bankenkrise, Arbeitslosigkeit, den barbarischen Nazis und einem schrecklichen Krieg. Doch Geschichte muss sich ja nicht komplett wiederholen. Wir – geleitet von klugen Fiskal- und Geldpolitikern – hätten ja noch bis 2029 Zeit dafür zu sorgen, dass es dieses Mal besser endet. Ich jedenfalls hätte nichts dagegen, wenn ein deutscher Kanzlerkandidat des Jahres 2021 – ähnlich wie damals Warren G. Harding – mit dem Wahlspruch »Auf in die wilde Normalität« in den Kampf zöge. Meine Stimme hätte er.
Rainer Hank
