Hanks Welt
Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).
Aktuelle Einträge
25. Juni 2025Vom New Deal zum Real Deal
08. Juni 2025Geld her!
27. Mai 2025Wer stoppt Trump?
10. Mai 2025Ein Herz aus Stammzellen
14. April 2025Lauter Opportunisten
07. April 2025Die Ordnung der Liebe
29. März 2025Streicht das Elterngeld
17. März 2025Der Kündigungsagent
17. März 2025Hart arbeiten, früh aufstehen
04. März 2025Kriegswirtschaft
12. Mai 2020
Krieg und Krise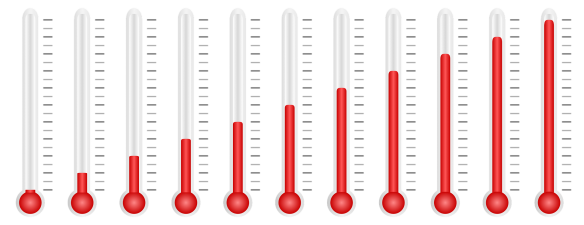
Warum martialische Vergleiche mehr erklären als gedacht
Wir sind im Krieg! Für diesen Satz in der Corona-Krise ist der französische Präsident Emmanuel Macron arg gescholten worden, zumindest hierzulande. Auf den ersten Blick liegt Macron gewiss komplett falsch: Im Krieg gibt es klare Feinde, es gibt am Ende Sieger und Besiegte und schreckliche Zerstörung auf allen Seiten. Es gibt Täter und Opfer, Angreifer und Verteidiger. Das alles wird uns gerade an diesem Wochenende in Erinnerung gebracht, dem 75. Jahrestag der Kapitulation und Befreiung.
Falsch wäre es indessen, den Vergleich der Corona-Krise mit dem Krieg gänzlich ad acta zu legen. Bei näherem Hinsehen gibt es nämlich eine ganze Reihe auffälliger Gemeinsamkeiten. Den Sinn dafür hat uns Harold James geschärft. Der Mann ist Wirtschaftshistoriker, lehrt und forscht an der Universität Princeton und hat vor kurzem in der nicht genug zu lobenden Webinar-Serie seines Princeton-Kollegen Markus Brunnermeier über »Corona-Lektionen« der Kriegs- und Nachkriegszeiten 1918 und 1945 gesprochen. Wie heute wird auch in Kriegszeiten die normale Wirtschaft stillgelegt, nationale Grenzen werden für Menschen, Güter und Dienstleistungen dicht gemacht. Es gibt nur noch ein Thema, dem sich alles andere unterzuordnen hat. Der Staat setzt bürgerliche Freiheiten außer Kraft, gesellschaftliches Leben erstirbt. Dafür nehmen die Staatsschulden in Kriegen ungeheure Ausmaße an, ohne dass es daran nennenswert Kritik gibt. Im Gegenteil: Die Regierungen profitieren im Ansehen bei ihrer Bevölkerung, die Umfragewerte regierenden Partei gehen nach oben. »Rally-round-the-flag« nennt die Politikwissenschaft dieses Phänomen freiwilliger Bürger-Loyalität: In schweren Zeiten versammeln wir uns hinter unseren Führern. Das Parlament akklamiert, die Opposition verstummt.
Keiner weiß, wie lang es dauert
Harold James listet noch eine Reihe weiterer Gemeinsamkeiten auf zwischen Krieg und Pandemie. Besonders überzeugt hat mich die Beobachtung, dass die Menschen nicht wissen, wie lange der Krieg oder die Pandemie dauern, man nicht planen kann und dass genau diese Unsicherheit sich als psychisch zermürbend herausstellt. Durchhalteparolen und Drohszenarien aus Regierungskreisen haben das Ziel, die Menschen bei der Stange zu halten: Angstgetriebene Konformität allerorten. Viel Moral ist im öffentlichen Angebot, achtet man etwa auf die Solidaritäts- und Gemeinwohlrhetorik seit Ausbruch der Corona Krise.
Damit ist der Vergleich noch lange nicht erschöpft. Wirtschafts- und finanzpolitisch geht es darum, wie man nach dem Shutdown wieder in den Zustand der Normalität zurückfindet. Wenn es gut geht, sorgt ein ordentliches Wachstum in der Wiederaufbauzeit dafür, dass die Staaten aus ihren Schulden herauswachsen. Und wenn es gut geht, konsumieren die Menschen dann wieder freudig, anstatt sich in eine Deflation hinein zu sparen, während gleichzeitig eine umsichtige Geld- und Fiskalpolitik dafür sorgt, dass dies am Ende nicht in eine überschießende Inflation fließt. Wenn es schief geht, gibt es einen Schuldenschnitt und das Geld ist weg.
Der Oberbegriff für Krieg und Pandemie heißt Krise. Die FAZ-Dokumentation hat gezählt, dass der Begriff Krise in den führenden deutschen Medien im April 2020 noch häufiger auftaucht als im Krisenmonat des Zusammenbruchs von »Lehman Brothers« im September 2008. Doch was überhaupt ist eine Krise? Auch dafür habe ich eine hilfreiche Hörempfehlung: Petra Gehring, eine an der TU Darmstadt lehrende Philosophin, hat im Jahr 2017 eine Vorlesung gehalten zum Thema »Philosophische Krisendiagnosen im 20. Jahrhundert«, die man im Netz bequem nachhören kann. Gerade weil diese Vorlesung noch keine Kenntnis der Corona-Krise haben konnte, sind die Gedanken der Philosophin hilfreich.
Dabei zeigt sich: Der Begriff der Krise kommt ursprünglich aus der Medizin. Kranke Körper kommen früher oder später in die Krise, jenem Höhepunkt des Krankheitsverlaufs, in welchem sich der Ausgang der Sache entscheidet. Die Krankheit ist ein Prozess, an dessen fiebrigem Höhepunkt völlig in der Schwebe ist, wie alles enden wird: mit Heilung oder Tod. Die Krise selbst bringt die ganze Gesellschaft ins Fieber. Man kann das als Kurve zeichnen mit einem Scheitelpunkt: bezogen auf heute ist das jener Punkt, an dem die Zahl der Infizierten zurückgeht, R kleiner Eins wird – und alle aufatmen. An Corona können wir sozusagen die Urform einer Krise ablesen.
»Alles wird neu!«
Die Fieberkurve mit Scheitelpunkt wurde nicht nur in der Ökonomie das Modell für das Auf und Ab des Konjunkturzyklus, sondern auch in der Militärwissenschaft Vorbild für die Beschreibung von Kriegen als Krisen. Stets bleibt der Krisenbegriff ambivalent. Das zeigt die Floskel von der »Krise als Chance«; die auch heute wieder gerne genommen wird. Es wird dann die Zeit vor der Krise abgewertet (übertriebene Globalisierung, unmenschlicher Kapitalismus, Konsumismus, Egoismus), während das Gute der Krise darin bestünde, die »wahren« Bedürfnisse der Menschen offen zu legen, die Menschen zum »Eigentlichen« zu führen und überhaupt alles zum Besseren zu wenden. Es werde keine Normalität geben »wie vorher«, so tönt es jetzt aus den öffentlich-rechtlichen Fernsehgeräten, eine Drohung, die sich als Verheißung camoufliert.
»Alles wird neu!« heißt der Slogan dieser Krisen-Propheten, als dessen Ahnherrn Petra Gehring den Basler Historiker Jacob Burckhardt anführt. In Burckhardts berühmten »Weltgeschichtlichen Betrachtungen« aus dem Jahr 1905 trägt ein großes Kapitel die Überschrift »Die geschichtlichen Krisen«. Dort findet man nicht nur die Übertragung der medizinischen Terminologie auf Krieg und Frieden, sondern auch genau jene Solidaritätsbeschwörung, die uns heute eingetrichtert wird. Bei Burckhardt wird daraus ungeniert ein Lob des Krieges. Der lange Friede habe eine »eine Menge jämmerliche Existenzen« hervorgebracht: »Sodann hat der Krieg, welcher so viel als Unterordnung alles Lebens und Besitzes unter einen monumentalen Zweck ist, eine enorme sittliche Superiorität über den bloßen gewaltsamen Egoismus des einzelnen: er entwickelt die Kräfte im Dienst eines Allgemeinen, welcher zugleich die höchste heroische Tugend sich entfalten lässt. Er allein gewährt den Menschen den großartigen Anblick der allgemeinen Unterordnung unter ein Allgemeines.«
Würde man die etwas altertümliche Rhetorik des Basler Historikers ein wenig aktualisieren und das Wort Krieg konsequent durch Corona-Pandemie austauschen, dann gehe ich die Wette ein: Man könnte Jakob Burckhardt quasi inkognito unter die vielen Texte von Politikern und Fernsehkommentatoren schmuggeln, die uns heute weismachen wollen, dass die Krise auf wundervolle Weise zeige, wie der Staat in der Lage sei, alle Wirklichkeit einem Gemeinwohlinteresse unterzuordnen. Diese Erfahrung soll nun auch die Grundlage für eine neue solidarische Gesellschaft in der Nach-Corona-Zeit abgeben. Geläutert durch Corona würden wir die jämmerliche Existenz unseres Vorkrisen-Egoismus überwinden.
Sollte es uns nicht zu denken geben, dass die jetzt dem Corona-Ausnahmezustand zugeschriebene kathartisch-heroische Kraft ihren Ursprung hat in der Kriegsverherrlichung des Krisen-Theoretiker des 20. Jahrhunderts?
Rainer Hank
04. Mai 2020
In der Risikogruppe
Darf man den Wert eines Lebens in Geld beziffern?
»Willkommen in der Risikogruppe!«, das war meine Grußformel, die ich einem Freund anlässlich seines 60. Geburtstags vergangene Woche zurief. Nicht sehr feinfühlig, wir mir klar wurde. Wer will schon gerne ein Risiko sein, weder für andere noch für sich selbst. Wen immer ich derzeit aus meiner Kohorte spreche, hat daran zu knabbern. »Was mir der Coronakomplex antut, ist, dass er mich zum ›Senior› macht«, schreibt mir ein putzmunterer akademischer Emeritus: Die Politik wolle ihm Reisen zu Vorträgen oder Arbeitstagungen verbieten und ihm Berufsverbot erteilen, knurrt er. »Damit sie das kann, ernennt sie mich zum »Senior«, also überflüssig«, so der Emeritus.
Das alles ist eine gewaltige narzisstische Kränkung. Wir Alten – wie sich das schon anhört – rebellieren innerlich ununterbrochen. Die liebste Entlastungsübung geht so: Wir rechnen uns souverän aus der Risikogruppe raus. Denn biographisches Alter und biologisches Alter klaffen bekanntlich auseinander. »60 ist das neue 50«, so ungefähr jedenfalls geht das Spiel. Das alles, man muss es so klar sagen, sind mehr oder weniger hilflose Anstrengungen, die das Ziel haben, die sichtbare und zählbare Anwesenheit des Todes in den Hintergrund zu drängen. Aber wie soll man das nur schaffen, bei all den Statistiken zur »Übersterblichkeit«, mit denen wir täglich konfrontiert werden (von den Fernsehbildern der Särge ganz abgesehen).
Zwar bedroht die Corona-Pandemie die Menschheit als Ganze. Aber das Risiko nimmt mit dem Alter zu. All die Maßnahmen, die derzeit zur Abflachung der Infektionskurve unternommen werden, kommen – statistisch gesehen – mir mehr zugute als meiner fünfundzwanzigjährigen Nichte. Bislang waren wir gewohnt, die mit der steigenden Lebenserwartung verbundene demographische Entwicklung nahezu ausschließlich positiv zu interpretieren. Jetzt zeigt sich aber, dass dieser Gewinn an Lebenszeit für die Gesellschaft mit deutlich höheren Kosten und Unannehmlichkeiten verbunden ist.
Pandemie in Zeiten alternder Gesellschaften
Covid 19 sei die erste Seuche der Menschheitsgeschichte, die in eine Zeit fällt, in der mehr Menschen über 65 Jahre alt sind als unter fünf Jahren, schreibt Andrew Scott, ein Ökonom der London Business School. Wir sind mehr und wir leben länger. Das heißt einerseits, dass es viel mehr Menschen mit höheren Infektionsrisiken gibt als vor hundert Jahren und dass zugleich von den Maßnahmen sozialer und physischer Distanzierung, die jetzt überall vorgeschrieben sind, vor allem wir Älteren profitieren. Und dass dies der gesamten Gesellschaft mehr Geduld abverlangt als frühere Pandemien.
Corona, folgt man der Argumentation von Professors Scott, wird im Vergleich mit früheren Epidemien deutlich teurer und zwar ganz unabhängig von den billionenschweren Konjunktur- und Kreditprogrammen. Dies schlicht deshalb, weil mehr Alte gerettet werden müssen. Die Herleitung Scotts ist ein bisschen kompliziert, lohnt aber das Nachdenken: Im Jahr der Spanischen Grippe 1920 waren 8,5 Prozent der Bevölkerung älter als 60 Jahre; heute sind es 22 Prozent. Im Jahr 2050 werden es 28 Prozent sein. Weil nun das Risiko an Corona zu sterben mit dem Alter exponentiell wächst, nehmen im Umkehrschluss auch die Vorteile für die Älteren zu, die von einer erfolgreichen Politik der sozialen Distanz profitieren. Hätten wir heute eine Altersverteilung wie im Jahr 1920, würden die jetzt getroffenen Maßnahmen 580000 Leben retten, während heute 1,8 Millionen Menschen dem Tode entgehen.
Ökonomen schrecken vor nichts zurück und übersetzen die potenzielle Lebensrettung in Geld, indem sie jedem Leben einen statistischen Wert geben. Das klingt kalt, ist aber gleichwohl nicht abwegig. Natürlich gibt es keinen noch so hohen Geldbetrag, für den wir freiwillig unser Leben oder das eines geliebten Menschen hergeben würden. Doch darum geht es nicht. Wir stellen bei all unseren Handlungen selbst häufig ein Kalkül an, wissen zum Beispiel, dass Autofahren tödlich enden kann und machen es trotzdem bei (zumeist) vollem Risikobewusstsein. Um das Risiko tödlicher Autounfälle zu reduzieren, errichten die Kommunen Ampeln. Da man aber nicht an allen Kreuzungen Ampeln aufstellen kann, kommt man um eine Kosten-Nutzen-Analyse nicht herum, für die sich ein fiktiver Geldbetrag des Nutzens – genannt »Wert eines statistischen Lebens« – einsetzen lässt.
Solche Überlegungen spielen jetzt auch in der Corona-Krise eine Rolle. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat das vergangene Woche auf die ihm eigene Weise beschrieben: »Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig«. Die im Grundgesetz verankerte Menschenwürde schließe nicht aus, »dass wir sterben müssen«. Corona desillusioniert unsere Unsterblichkeitsphantasien.
Wir alten profitieren
Benutzt man den Wert eines statistischen Lebens in diesem Sinn, verliert die Rechnung ihren Zynismus. Andrew Scott, der Professor aus London, beziffert für Amerika den Wert der durch die Maßnahmen sozialer Distanzierung geretteten Menschenleben auf knapp acht Billionen Dollar. Die im Vergleich zu 1920 heute größere Anzahl älterer und länger lebender Menschen erfordert aber zugleich auch, dass der Shutdown dreimal so lang dauert als er 1920 für vergleichbare Ziele nötig gewesen wäre.
Was daraus folgt? Wir Alten sollten uns dreimal überlegen, wie laut wir die Einordnung als Risikogruppe beklagen. Denn objektiv profitieren wir überproportional – je älter umso mehr –, während der Löwenanteil der Kosten dafür von den Jüngeren geschultert werden muss. Statistisch gesehen tun die Jüngeren also mehr für mich als für sich.
Daraus könnte ein neuer Generationenkonflikt resultieren. Es bleibt ungenügend, die Jüngeren damit zu beschwichtigen, dass sie selbst auch einmal älter werden und im Fall einer abermaligen Pandemie dann auch von Jüngeren gerettet werden wollen. Das Argument der Gegenseitigkeit, das an den »Generationenvertrag« bei der gesetzlichen Rente erinnert, ist zwar richtig, aber etwas unfair, weil die hohen Kosten für die Jüngeren heute anfallen, während der künftige Nutzen erst später erzielt wird und noch dazu unsicher ist.Um einen drohenden Generationenkonflikt zu entschärfen, könnte es geraten sein, im weiteren Verlauf der Pandemie den Jüngeren mehr Freiheiten als den Älteren zu lassen. Es ließe sich die größere Freiheitsbeschränkung paternalistisch mit dem höheren Schutzbedürfnis der über Sechzigjährigen begründen, was dann als eine »gute« Diskriminierung kommuniziert werden könnte. Aber es wäre doch zugleich eine ziemlich dicke Entmündigung, wie sie bei kleinen Kindern, aber nicht bei vernünftigen Erwachsenen gerechtfertigt ist. Wäre es nicht besser, uns Alte selbst entscheiden zu lassen, welchen Risiken wir uns aussetzen wollen, natürlich bei Wahrung der Abstand- und Mundschutzregeln? Ethisch gibt es daran nichts auszusetzen: Wir müssen in Kauf nehmen, von Jüngeren angesteckt zu werden, sind aber unsererseits für die Jüngeren keine größere Gefahr als alle anderen Zeitgenossen.
Es gibt eben keinen absoluten Schutz vor dem Sterben. Jetzt nicht. Aber eben auch nicht, wenn Corona – hoffentlich bald – vorüber sein wird.
Rainer Hank
28. April 2020
Seuchensozialismus
Wie die Corona-Krise Utopien als Dystopien entlarvt
Was macht den Menschen am meisten Angst in dieser Krise? Josh Cohen arbeitet als Psychoanalytiker in seiner Praxis in London. In den vergangenen Wochen hat er viele Patienten behandelt, die ihm von ihren aktuellen Ängsten erzählt haben. Dabei stellte sich heraus: Schlimmer als die Angst sich zu infizieren, zerstörerischer als die Sorge um das künftige Einkommen ist die Erfahrung, plötzlich keine Arbeit zu haben. Leere und Sinnlosigkeit tun sich auf. »Ich habe Angst, mich selbst zu verlieren«, so berichtet Cohen die Aussage einer Patientin in einem Artikel im »Guardian«. Der Psychoanalytiker folgert: Jetzt spüren wir, wie abhängig wir davon sind, dass wir Arbeit haben.
Wenn nicht mehr selbstverständlich, wird plötzlich der Wert der Normalität bewusst. Arbeit ist unser Leben und ohne Arbeit verlieren wir uns selbst. Das wirft ein Licht auf einen breiten Strom von Utopien, welche die Befreiung von der Arbeit als Ziel der Menschheit beschrieiben. Oscar Wilde, der britische Exzentriker an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, träumte davon, dass im Sozialismus niemand mehr arbeiten müsse (»The Soul of Man«). Die Menschen bräuchten dann keine Sklaven mehr zu sein und könnten sich stattdessen Maschinen als Sklaven halten, um ihrerseits der Selbstverwirklichung zu frönen. Es sind Künstler-Träume einer befreiten Gesellschaft, die das unterdrückende Reich der Arbeit hinter sich gelassen hat.
Die Corona-Krise bietet unfreiwillig die Chance, die ein oder andere lieb gewordene Utopie dem Realitätscheck zu unterwerfen – zugegeben unter bösen Bedingungen. Viele dieser Utopien zerplatzen oder wandeln sich gar von der Utopie zur Dystopie, ihrem pessimistischen Gegenbild. Die Welt ohne Arbeit ist ja nicht nur die Fantasie früherer Sozialisten. Seit geraumer Zeit wird sie auch von heutigen Top-Managern großer Unternehmen propagiert: In einer digitalen Wirtschaft, in welcher die Roboter und Algorithmen die Arbeit übernehmen und für die Gewinne der Unternehmen sorgen, lasse sich eine Art Maschinensteuer abschöpfen, die allen Menschen ein garantiertes Grundeinkommen sichert, ohne dass sie dafür arbeiten bräuchten. Allzu fern von dieser Welt sind wir derzeit nicht: Das Kurzarbeitergeld, das viele jetzt beziehen, ist nichts anderes als eine Art »bedingungsloses Grundeinkommen«, um den entfallenen Lohn zu kompensieren. Doch jetzt spüren wir, Geld ohne Arbeit ist nicht die Erfüllung des Lebenssinns. Auch die Hoffnung, befreit von der Sklaverei entfremdeter Büroarbeit würden wir nun endlich in unserem Homeoffice kreativ und zu uns selbst finden, könnte trügen. Befriedigender ist es, wenn der Lohn »Belohnung« ist für die Arbeit und diese im sozialen Austausch stattfinden kann.
So also sieht Degrwoth aus
Ernüchterung gegenüber dem utopischen Potential einer »besseren« Welt lässt sich auch auf anderen Feldern studieren. So erleben wir derzeit, zweitens, auch den Praxistest der Degrowth-Idee, die häufig im Bündnis mit radikalen Umwelt- und Klimautopin daherkommt. Degrowth meint: Wir haben es mit dem Wachstum übertrieben, haben vergessen, was unsere wahren Bedürfnisse sind und sind dabei, mit unserer Gier uns selbst zu verlieren, darüber hinaus die Umwelt zu zerstören, mithin den nachfolgenden Generationen die Lebensgrundlage zu entziehen. Weltweit hat sich diese »Degrowth-Bewegung«, die für Wachstumsrücknahme, Bescheidung der Bedürfnisse oder aktive Schrumpfung wirbt und sich anschickt, die etwas angestaubte kapitalismuskritische Attac-Bewegung abzulösen. »Schnecken aller Länder, vereinigt euch!«, so lautet das Motto.
Radikaler und rascher als der Virus es geschafft hat, hätte es die Degrowth-Bewegung nie vollbringen können: Das erste halbe Jahr 2020 verläuft wirtschaftlich tatsächlich im Schneckentempo. Wir erleben einen Einbruch des Wachstums, wie er zuletzt während der großen Kriege des 20. Jahrhunderts zu beobachten war. Selten war der ökologische Fußabdruck der Menschen so schonend wie heute, dazu muss man sich nur den kerosinfreien blauen Himmel anschauen. Doch der Preis ist hoch: Quer durch alle Branchen brechen den Konzernen die Umsätze weg und der Bewegungsradius der Menschen ist aufs Äußerste reduziert, auf den Alltag in Heim und Herd.
Das hängt, drittens, mit der Frage zusammen, ob wir es mit der Globalisierung übertrieben haben. Auch davon sind viele überzeugt: Weil wir alle global vernetzt sind, habe es nur wenige Wochen gebraucht bis das Virus überall auf der Welt mit exponentieller Geschwindigkeit sein Geschäft habe erledigen können. Unsere Abhängigkeit von der weltweiten Arbeitsteilung führe jetzt dazu, dass Medizin und Mundschutz, weil in China produziert, hierzulande nicht mehr zur Verfügung stünden. In der Tat: Globalisierung und Verletzlichkeit gehören zusammen. Aber was ist die Alternative? Eine Welt, wie jetzt, in der die nationalen Grenzen so dicht sind wie nie? Das mag die Welt sein, die TTIP-Gegner (wer weiß noch, was das war?) sich wünschen. Für Liberale hingegen bleiben offene Märkte essentiell, und gute Linke müssten darauf pochen, dass auch Migration in einer Welt geschlossener nationaler Clubs zum Erliegen kommt. Schon 50 Flüchtlingskinder aus Griechenland scheinen inzwischen Deutschland zu überfordern.
Der Abgrund der Staatsbedürftigkeit
Was ist, viertens, mit dem Staat, den so viele sich zurückgewünscht haben, um den imperialen Neoliberalismus zu bändigen? Jetzt ist er wieder da. Der Staat nimmt Billionen Euro in die Hand, so viel Geld wie noch nie, um die Schäden der Krise zu begrenzen. Aber auf den aktuellen Nutzen folgen spätere Kosten. Wo überall sie anfallen werden (Inflation, Schrumpfen des Sozialstaats, oder eher Deflation) weiß heute noch niemand. Wenn das Geld vom Staat (und nicht vom Kunden) kommt, schulen Unternehmer sich im »Rent-Seeking«, im Geld abholen, wo es geht: die KfW wird es schon richten. Es siegt der Cleverste. In dieser Welt geht es fast so raffgierig zu, wie die Staatsfreunde sich immer die Kapitalisten vorstellen. Der Staat ist als Planer jetzt in der Tat gefordert, aber zugleich völlig überfordert, wenn er sich zum Beispiel anmaßt zu wissen, ob ein Händler mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche weniger infektionsgefährdend ist als mit 810 Quadratmetern. In der Krise zeigt sich die Staatsbedürftigkeit unserer Gesellschaft, aber auch deren Abgründigkeit.
Es mag nicht fair sein, den utopischen Gehalt der Corona-Welt zum Indiz für ihre dystopische Wirkung zu machen. Doch als Rechenübung könnte gelten: Man nehme das Krisen-Design (Ersatzeinkommen ohne Arbeit, Wirtschaft ohne Wachstum, Handel im Nahbereich und ohne Migration, Anerkennung der Staatsbedürftigkeit) und ziehe davon Corona ab. Ist das, was übrigbleibt, dann jene »bessere Welt«, die zu bauen die Krise zur Zäsur und Chance werden ließe, wie jetzt viele sagen. Ich gestehe: Da ist mir die gute alte Welt vor Corona lieber. Lieber jedenfalls als der neue Seuchensozialismus jener orakelnden Propheten, die uns, frei nach Karl Popper, ein Paradies versprechen, das sich am Ende als Hölle erweisen könnte.
Rainer Hank
21. April 2020
Von wegen kaputtgespart
Wie gut sind deutsche Krankenhäuser?
Man habe unser Gesundheitssystem »kaputtgespart«, so liest es sich derzeit vielerorts. Schuld daran seien Ökonomisierung und Privatisierung der Medizin: Gewinne für börsennotierte Krankenhausgesellschaften gingen auf Kosten medizinisch unterversorgter Patienten. Besonders viel Häme ergießt sich über die Bertelsmann Stiftung, die im vergangenen Jahr vorgeschlagen hat, jede zweite Klinik in Deutschland zu schließen und die Zahl der Krankenhausbetten drastisch zu reduzieren.
Vor dem Hintergrund der derzeitigen Corona-Lage nimmt sich das auf den ersten Blick seltsam aus. Werden nicht verzweifelt Betten für die schwerkranken Infizierten gesucht? Um wie viel schlimmer stünden wir da, hätten wir den Empfehlungen all dieser Studien nachgegeben! Eine Lehre der Krise, so folgern jetzt viele, müsse es sein, die Gesundheit den privaten Akteuren zu entziehen und dem Staat oder, wie früher, der Barmherzigkeit der Kirche zu überantworten.
Was ist dran an der These des Kaputtsparens? Es empfiehlt sich ein Blick in die Studie »Gesundheit auf einen Blick« der OECD. Die neueste Ausgabe ist aus dem Jahr 2019 und analysiert die Situation der reichen Länder der Welt. Generell gilt: Überall auf der Welt wird den Menschen ihre Gesundheit immer mehr wert. Die Gesundheitsausgaben steigen – von durchschnittlich 8,8 Prozent der Wirtschaftsleistung auf prognostiziert 10,2 Prozent im Jahr 2030. Deutschland (heute schon knapp 12 Prozent) nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein nach den Vereinigten Staaten und der Schweiz. Während einige wenige Länder (dramatisch Griechenland, aber auch Italien) ihre Ausgaben für Gesundheit zurückgefahren haben (ob es am Austeritätszwang der EU lag, ist fraglich), gibt Deutschland kontinuierlich mehr Geld aus: Je Einwohner stiegen die Ausgaben zwischen 1993 und 2017 von 2400 auf 4000 Euro (in Preisen von 2010).
Wir leisten uns immer mehr Gesundheit
Damit haben wir ein erstes Ergebnis: Keine Rede von Kaputtsparen, noch nicht einmal vom Sparen. Im Gegenteil: relativ zu anderen Dingen des Lebens leisten wir uns immer mehr Gesundheit. Damit ist – wohlgemerkt – die Frage noch nicht beantwortet, ob wir auch gute Medizin für unser Geld bekommen. In den Vereinigten Staaten, die derzeit schon 18 Prozent des Sozialprodukts auf die Gesundheit verwenden, spricht einiges dafür, dass zwar viele Gesundheitslobbyisten, aber nicht die Kranken und schon gar nicht die Ärmsten der Armen von dem internationalen Gesundheits-Spitzenplatz profitieren. Doch dazu gleich mehr.
Zunächst zum zweiten Bösewicht, dem Privatisieren. Dazu lohnt die Lektüre des Gesundheits-Kapitels aus dem Jahresgutachten 2018/2019 des deutschen Sachverständigenrats. Hierzulande stiegen die staatlichen Gesundheitsausgaben zwischen 1993 und 2017 um 130 Prozent auf jährlich 230 Milliarden Euro an, während sich im selben Zeitraum die nominalen Gesamtausgaben des Staates »lediglich« um 70 Prozent erhöhten. »Das Gesundheitswesen bildet nach der sozialen Sicherung, insbesondere der Alterssicherung, den größten Ausgabeposten des Staates«, schreiben die Fünf Weisen. Das wäre dann das zweite Ergebnis: Von einer Entstaatlichung kann bei solchen Steigerungen staatlicher Ausgaben nicht die Rede sein. Dabei werden die Krankenhausleistungen natürlich auch von Privaten angeboten. Grob gesagt sind es jeweils ein Drittel Private, ein Drittel Staatliche und ein Drittel kirchliche oder andere gemeinnützige Träger. Ob es besser wäre, alle Leistungen würde der Staat anbieten? Wer das gut findet, soll sich das zu hundert Prozent staatliche, »kostenlose« National Health-System (NHS) Großbritanniens anschauen, eine Ikone des britischen Wohlfahrtsstaats, dessen Performance in der Corona-Krise dramatisch schlechter ausfällt als das deutsche System.
Kleine und mittlere Kliniken versagen
Nun zur zentralen Frage: Wie effizient sind unsere Krankenhäuser? »Sie könnten viel effizienter sein«, sagen nicht nur die Bertelsmann Stiftung, sondern auch der Sachverständigenrat und die Gesundheitsberater der Bundesregierung. Im internationalen Vergleich leistet sich Deutschland mit 800 Krankenhausbetten auf 100000 Einwohner besonders hohe Kapazitäten. Aber darunter gibt es viele kleine und mittelgroße Häuser, die wenig spezialisiert sind und gleichwohl den Anspruch haben, alles anzubieten. Viele Kreise und Gemeinden halten daran aus Prestigegründen fest. Zahlen aus dem Jahr 2016 zeigen: Ein Fünftel der Krankenhäuser haben keine Intensivbetten; ein gutes Drittel verfügt noch nicht einmal über eine eigene Computertomografie. Spezialisierung und Skaleneffekte – für viele klingt das ökonomistisch – würden die Qualität verbessern. Ein Chefarzt einer mittleren Klinik, der vom Herz bis zur Blase alles, aber selten, operiert, ist gesundheitsgefährdend.
Nachfrage bei Lars Feld, dem Vorsitzenden des Sachverständigenrats, der das Gesundheitskapitel des Jahresberichts 2018/19 mitverantwortet, ob er sich heute für den damaligen Vorschlag schämt, »Überkapazitäten« der Krankenhäuser drastisch zurückzufahren. »Nein«, sagt Feld. Die Corona-Pandemie zeige doch einerseits, wie gut es gelinge umzusteuern und mehr Intensivbetten zu bekommen. Es zeige sich aber auch, dass gerade kleinere Kliniken unzureichend für die Intensivversorgung ausgestattet seien. Das gehe wesentlich darauf zurück, dass die das bislang nicht brauchten. Felds Hauptargument für eine notwendige Konzentration im Krankenhaussektor mit größeren Zentren und einer geringeren Zahl kleiner Häuser: Größere Klinik-Zentren haben mehr Erfahrung mit einer Vielzahl von Behandlungen, weil sie mehr Fälle verarzten. Kleinere Häuser können dies nicht leisten und sind damit ein Risiko für die Patienten. Felds Vorbild heißt Dänemark, wo man diesen Weg der Konzentration und Modernisierung konsequent geht. »Ich kann nicht erkennen, dass in Dänemark eine schlechtere Versorgung als in Deutschland in dieser Pandemie geleistet wird.«
Die deutschen Kliniken haben nicht versagt. Derzeit gibt es ausreichend Beatmungsgeräte und 11000 freie Intensivbetten. Natürlich kann man sich alarmistisch Szenarien einer steigenden Reproduktionsrate »R« durch Corona-Infektionen ausdenken, was einen Kollaps des Systems zur Folge hätte. Aber R geht zurück (aktuell stecken zehn Infizierte »nur noch« sieben weitere an). Hätte Deutschland sich gleichwohl besser vorbereiten müssen? Auch das behaupten jetzt viele und verweisen auf einen »Risikobericht« der Bundesregierung aus dem Jahr 2013, in dem ziemlich genau eine gefährliche Pandemie simuliert wird wie wir sie derzeit erleiden. Darin stand auch, dass so etwas alle hundert Jahre passieren könne – also genau jetzt, hundert Jahre nach der Spanischen Grippe »Und nichts Präventives geschah«; schimpfen die Kritiker. Doch abgesehen davon, dass man hinterher immer klüger ist: Hätte man für einen Zeitpunkt, den keiner kennt, in ganz Deutschland 40000 leere Intensivbetten vorhalten sollen? Es kommt doch viel eher darauf an, im Fall der Pandemie rasch umzusteuern. Das scheint das deutsche System zwar nicht perfekt, aber offenbar besser als andere zu schaffen. Es wäre womöglich noch besser gerüstet gewesen, hätte man den Prozess der Konzentration, Spezialisierung und Modernisierung der Krankenhäuser früher in Angriff genommen.
Rainer Hank
14. April 2020
Die gute Hirtin Angela
Die Kanzlerin und der deutsche Polizeistaat
Zanderfilet mit geschmortem Fenchel und Knoblauch-Kartoffelstampf hat Christian Jürgens uns in seiner Kochkolumne jüngst vorgeschlagen. Jürgens ist Chefkoch des legendären Restaurants »Überfahrt« in Rottach-Egern am Tegernsee, auf den Mann ist Verlass. Sein Zander-Rezept eigne sich hervorragend für große Gruppen, schreibt Jürgens, er habe es oft für die Großfamilie am Karfreitag zubereitet. Das war der Moment, an dem ich innerlich zusammenzucke: Große Gruppen? Das geht doch gar nicht, durchfährt es mich. Ich komme ins Grübeln: Oder ist das gemeinsame Essen in der Großfamilie noch erlaubt, wenn die Verwandtschaftsbeziehung hinreichend eng ist? Da müsste man noch einmal im staatlich erlassenen Corona-Manual nachschlagen. Ich ahne, Großfamilie wird wohl auch verboten sein.
Soweit ist es also gekommen: Innerhalb von drei Wochen ist uns der Abstandhaltereflex zur zweiten Natur geworden. Statt uns das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen bei der Vorstellung von konfiertem Zander, werden Furcht und Angst mobilisiert. Es ist die Wiedergeburt autoritärer Persönlichkeitszüge aus dem Geiste von Corona. Der »autoritäre Charakter«, schreibt der Philosoph Erich Fromm, zeichnet sich durch Unterwürfigkeit und Konformitätsverhalten aus, ein Verhalten der Anpassung, hinter welchem Angst und Aggression nur schwer sich verbergen können.
Wir hatten es tatsächlich gewagt, in der Karwoche – natürlich nur zu zweit – von Frankfurt aus einen kleinen Ausflug in den nahe gelegenen Rheingau zu machen, um eine Stunde lang dort spazieren zu gehen. Die Sache verlief äußert corona-korrekt: Fünf Meter Abstand zu allen Fremden waren gesichert, keine Gefahr sich nähernder Radler, denn die waren polizeilich verboten. Als wir zum Auto zurückkamen klebte unter dem Scheibenwischer eine Tempotuch mit der Botschaft mutmaßlich eines Einheimischen: »Bleibt bitte zuhause!« Die Bitte ist die höfliche Form der Drohung: das nächste Mal stechen wir euch die Reifen ein. Präzise lässt sich hier die Entstehung der Fremdenfeindlichkeit beobachten; Xenophobie ist die Schwester der Angst. Ihr Inhalt ist irrational: Als ob wir böse urbane Viren in die reine Luft des Rheingaus verpusten würden.
Kollateralschaden der Pandemie
Man muss es wohl als Kollateralschaden der Pandemiebekämpfung ansehen: Die massiven Einschränkungen bürgerlicher Freiheiten (Gewerbefreiheit, Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit, Glaubensfreiheit) schreiben sich ohne Murren in unser Fühlen und Verhalten ein. Wir wollen alles richtig machen, ermahnen die anderen, wenn sie es falsch machen und entdecken befremdet einen kleinen, bislang unbekannten Denunzianten in uns. Wer das auch nur mit skeptischer Distanz beschreibt, bekommt, im wahrsten Sinn des Wortes, das Totschlagargument zu hören: Schließlich gehe es jetzt um Leben und Tod. Und da sollten wir froh sein, dass der Staat sich um uns kümmere.
Dem Staat als Kümmerer entspricht der Bürger als Untertan. Im Diskurs über die Staatsaufgaben, der sogenannten Staatszwecklehre, rangiert der Kümmer- oder Obrigkeitsstaat historisch am Anfang: Es ist ein Polizeistaat, ein Begriff, der von 16. bis zum 18. Jahrhundert einen durchaus positiven Klang hatte, ging es doch um die gute Verwaltung der »Polis«. Die »gute Policey« bezieht sich auf die Aufgabe des Staates, für Ordnung im Gemeinwesen zu sorgen. Dazu gehört es, sich um Sicherheit, Wohlfahrt, Nützlichkeit und Glückseligkeit der Bürger zu kümmern, zu deren Durchsetzung es dann auch Staatsdiener – »Polizisten« – braucht, welche hoheitliche Aufgaben wahrnehmen. Es ist der Anspruch einer weitgehenden Allzuständigkeit des Staates, der als Garant des kollektiven und individuellen Wohls sich versteht. Die Polizei, so erklärt der Jurist Johann Heinrich Gottlob Justi (1720 bis 1771), ist dasjenige, was es dem Staat gestattet, seine Macht zu vermehren und seine Gewalt in vollem Umfang auszuüben. Die Polizei soll die Leute in einen glücklichen Zustand bringen und erhalten, wobei das Glück als Überleben, Leben und besseres Leben verstanden wird. Einen Unterschied zwischen kollektivem und individuellem Wohl und Nutzen kennt der Polizeistaat nicht – weil ihm die Vorstellung bürgerlicher Freiheit fremd ist.Fast will es scheinen, als ob der Einbruch einer archaischen Seuche, gegen die es weder Therapie noch Impfung gibt, und der gleichzeitige Rückfall des Staates in eine seiner Frühformen einander auf merkwürdige Weise korrespondieren. Eine Pandemie bekämpft man am besten mit dem Polizeistaat, wird uns suggeriert: Der soziale Abstand muss polizeilich überwacht werden. Es geschieht alles nur zu unserem Besten.
Foucaults Pastoralmacht
Der französische Philosoph Michel Foucault hat zur Beschreibung der Wirkung des Polizeistaats den schönen Begriff der Pastoralmacht eingeführt, ein Begriff, an den man gerne an diesem Osterfest erinnern mag. Der Pastor ist der »gute Hirte« seiner Herde, für deren Wohl er verantwortlich ist: ein kurzes Sonnenbad auf einer Parkbank hat Landspastor Markus Söder uns deshalb jetzt erlaubt. Der Hirte sammelt, führt und leitet seine Schafe. Die Rolle des Hirten besteht darin, das Heil seiner Herde sicherzustellen. Zielgerichtetes Wohlwollen nennt Foucault die Aufgabe des Hirten: Dafür muss er sogar ausnahmsweise die Herde verlassen und sich auf die Suche nach einem einzelnen verlorenen Schaf zu begeben. Das Verhältnis zwischen Hirte und Herde ist alles andere als äußerlich: Seine Fürsorge schreibt sich tief in das kollektive Verhaltensgewissen der Herde ein.
Die nun schon so lange regierende deutsche Kanzlerin hat in ihrer letzten Phase eine zu ihr eigentlich gar nicht passenden Rolle gefunden: Sie ist die »gute Hirtin« dieses Osterfestes 2020. Sie sagt uns, was wir zu tun und zu lassen haben und warum es nur zu unserem Besten ist. Sie tadelt uns, ermahnt uns, in der Disziplin nicht nachzulassen, lobt uns aber auch, wenn wir uns korrekt verhalten. Die Drohung mit der bösen Policey überlässt die Bundes-Pastorin den Männern in den Gauen, Markus Söder oder Armin Laschet.
Es ist müßig zu fragen, ob es eine der Freiheit kompatiblere Politik gegeben hätte, die Pandemie zu bekämpfen als die des Polizeistaates. Man darf der guten Hirtin auch attestieren, dass ihre pragmatische Rhetorik uns deutlich lieber ist als die Kriegsmetaphorik aus Frankreich oder den Vereinigten Staaten. Gleichwohl sollten wir uns nicht einreden lassen, der Polizeistaat sei in der Krise alternativlos. Das ist er nicht, er ist womöglich nicht einmal besondere effizient. Paul Romer, ein Ökonom an der New York University, schlägt zum Beispiel massenhafte Tests vor: Jeder der negativ ist, würde auf der Stelle in die Freiheit entlassen; das gesellschaftliche Leben könnte rasch weitergehen.
Alles kommt jetzt darauf an, den Polizeistaat schnell wieder in Richtung des freiheitlichen Rechtsstaats zu verlassen. Denn das Schlimmste an der autoritären, fürsorglich daherkommenden Pastoralmacht ist, dass sie die autoritären Anteile unseres Selbst kitzelt. Dabei heraus kommt eine Melange von Angst, Aggression und beflissenem Untertanengeist, Züge, die uns aufs Äußerste unangenehm sind. Und die sich auf keinen Fall verfestigen sollen.Rainer Hank
