Hanks Welt
Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).
Aktuelle Einträge
17. Dezember 2025Mehdorn war's nicht
15. Dezember 2025Folterwerkzeuge
02. Dezember 2025Kriegskinder
02. Dezember 2025Keine neue Hüfte
02. Dezember 2025Hongkong als Vorbild
26. November 2025Überraschend robust
26. November 2025Zugang ist alles
21. November 2025Das letzte Stück Kuchen
21. November 2025Rentner streicheln
19. Oktober 2025Wird KI zur Blase?
12. Januar 2021
Hans im Unglück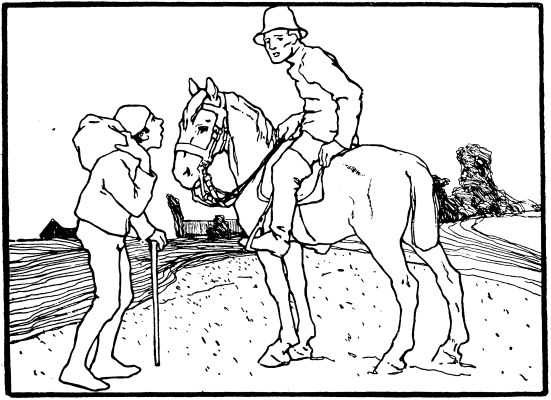
Wer zu spät kommt, taugt nicht zum Spekulanten
Dass ich zum Spekulanten nicht tauge, hat mir diese Corona-Krise wieder einmal eindrücklich vor Augen geführt. Wenn wir schon unter dieser gottverdammten Pandemie leiden, so dachte ich, dann ließe sich zur Entschädigung nach Wegen am Aktienmarkt suchen, davon wenigstens finanziell zu profitieren. Doch da ging es mir nicht anders als der EU, die im Sommer vor der Frage stand, welches Pharmaunternehmen als erstes mit einem Impfstoff auf den Markt kommen würde. Dass Biontech das Rennen machen würde, konnten nur Hellseher wissen. Und als man es dann wusste, war es zum Investieren zu spät, weil die Kurse längst durch die Decke gingen.
Was mir nicht in den Sinn kam, war eine alte Spekulanten-Weisheit aus den Zeiten des amerikanischen Goldrausches. Statt in Goldminen zu investieren, empfiehlt es sich, Aktien der Schaufel- oder Siebhersteller zu kaufen. Denn Schaufel und Sieb braucht jeder Goldsucher, einerlei, ob er am Ende fündig wird oder nicht. Wer stellt eigentlich die Gläschen her, in die jetzt die Impfdosen abgefüllt werden? Woher kommen die Milliarden an Spritzen? Und wer fertigt die Kühlaggregate, die den Biontech-Impfstoff auf minus 70 Grad eisgekühlt halten? Das sind die Schaufelhersteller der Corona-Pandemie.
Nun gut, der Schaufel-Einfall kam mir ebenfalls nicht. Besser gesagt: er kam mir erst, nachdem ich einen Artikel im F.A.Z.-Finanzteil darüber gelesen hatte. Und da war es dann abermals zu spät und die Gerresheimer-Aktie (Glasfläschchen) schon viel zu teuer. Merke: Wer zu spät kommt, taugt nicht zum Spekulanten.
Wer weiß, was ein ETF ist?
Mein einziger Trost: Ich bin in allerbester Gesellschaft. »Geld können wir immer brauchen«, schreibt mir dieser Tage eine Bekannte. Aber um die Geldkompetenz – vornehm »financial literarcy« – steht es in unseren aufgeklärten Zeiten zum Trotz nicht zum Besten. Gerne würde ich die Wette machen, wie viele W3–Professoren deutscher Universitäten wissen, was ein ETF ist. Nicht sehr viele, vermute ich. Empirisch gut untersucht sind die sogenannten »Big-Three«-Fragen: Da soll man zum Beispiel sagen, ob aus hundert Euro bei einem Zinssatz von zwei Prozent in fünf Jahren exakt 102 Euro oder mehr oder weniger als 102 Euro geworden sind. Lediglich jeder zweite Deutsche beantwortet diese Frage richtig. Kleiner Trost: In Italien kennt nur jeder Vierte die Antwort.
Vieles spricht dafür, dass Geld-Kompetenzen ähnlich wie Klavier- oder Fußballspielen in frühen Jahren erworben werden. Bei uns zuhause galt wie in vielen Familien der Grundsatz, dass man über Geld nicht sprach. Mein Vater hat nie verraten, was er verdient. Ich sah bloß, dass es immer knapp war.
Eine schöne Geschichte erzählt Patrick Jenkins, stellvertretender Chefredakteur der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times. Aufgewachsen im Süden von Wales als Kind eines Musiklehrers und einer Psychologin hätten seine Chancen ziemlich schlecht gestanden, dass aus ihm einmal ein Finanzexperte würde. Doch zu seinem sechzehnten Geburtstag erhielt Patrick ein Geschenk von seinem Vater: British-Telekom Aktien im Wert von hundert britischen Pfund, ausgegeben anlässlich der Privatisierungswelle in den Thatcher-Jahren. Die Folge: Patrick Jenkins studierte täglich aufmerksam die Kursseiten des Daily Telegraph, freute sich über jedes Pfund, das sein kleines Depot an Wert zunahm. Und, was noch mehr wert war, fortan wusste er Bescheid. Das, so sieht er es selbst, war die Voraussetzung dafür, dass er heute an der Spitze einer der wichtigsten Finanzzeitungen der Welt steht.
Es gab in Deutschland viele Eltern und Patenonkel, die nach dem Fall des Postmonopols in den neunziger Jahren ein kleines Päckchen Telekom-Aktien von Ron Sommer den Neugeborenen als Taufgeschenk mitbrachten. Das ist gründlich schief gegangen. Aus Schaden wird man nicht in jedem Fall klug: Seither halten sich viele Deutsche von Aktien fern.
Das Hans-im-Glück-Syndrom
Es gibt eine noch gefährlichere Art finanzieller Unbildung, die auf den ersten Blick als kompetentes Expertentum daherkommt, am Ende aber geradewegs in die Katastrophe führt. Dazu lohnt die Lektüre der vor Kurzem unter dem Titel »Glücksritter« erschienenen »Recherche über meinen Vater« des Berliner Schriftstellers Michael Kleeberg. »Mein Vater hatte immer Pech gehabt, wenn es um Geld gegangen war oder immer die falsche Entscheidung getroffen.« Dabei sei Geld eigentlich zuhause ein großes Thema gewesen, lässt der Rechercheur uns wissen: schon als kleines Kind redeten die Eltern in seiner Gegenwart darüber. Stolz gab sich der Vater, dass er keine »Lohntüte« erhielt, die der Sohn sich wie ein konusförmiges Papiertütchen vorstellte, sondern ein »Gehalt«. Das Gehalt, ausgezahlt am 15. des Monats, erhebt den Angestellten über den Arbeiter, der erst am Monatsende seinen Lohn bekommt.
Der Angestellte dünkte sich etwas Besseres und wollte mehr. Vater Kleeberg machte sich auf den Weg vom Kleinbürger zum Kleinunternehmer – und scheiterte dramatisch. Ein Geschäftspartner, dem er blind vertraute, hatte ihn arg über den Tisch gezogen – am Ende war all sein Geld weg. Um Scham und Schande auszuwetzen stürzte er sich in immer neue finanzielle Abenteuer: In späten Jahren fiel er gar Betrügern zum Opfer, die ihn mit sogenanntem »Vorschussbetrug« abzockten. Der Trick dabei: Bevor das »Versprechen« eines Millionengewinns eingelöst wird, werden die Opfer zu einer »Vorauszahlung« gedrängt. Die versprochene Leistung bleibt jedoch aus. Erst spät war der Sohn dahintergekommen; zehn Millionen Euro hatte der Betrüger dem Vater versprochen, 15000 Euro hatte der Vater ihm dafür als Vorschuss in den Rachen geworfen.
Unverstanden bleibt dem Sohn Kleeberg, warum der Vater, ein Mann, der eigentlich besessen war vom Geld, am Ende seines Lebens finanziell alles falsch gemacht hatte. Finanzielle Un- oder Halbbildung führt dazu, dass das Vermögen darbt. Finanzielle Besessenheit führt schlimmstenfalls dazu, dass am Ende das ganze Geld weg ist.
Warum lernen wir nicht wenigstens aus solchen negativen Erfahrungen? Womöglich hängt es mit einem Phänomen zusammen, das die Psychologen »Hans-im-Glück-Syndrom« nennen und das sich beim Vater des Schriftstellers Kleeberg quasi lehrbuchhaft nachzeichnen lässt. Das Hans-im-Glück-Syndrom kommt bei Zockern (sei es an der Börse oder im Casino) vor, die erst aufhören können, wenn der ganze Einsatz verspielt ist. Dann entsteht – wie im Märchen der Brüder Grimm – ein kurzfristiges Hochgefühl der Befreiung und der Erleichterung, dass es vorbei ist. Aber wie geht es weiter, wenn das Märchen zu Ende ist? Dann folgt der Katzenjammer: Was verloren und verspielt ist, muss um jeden Preis verdrängt werden. Denn sonst wäre Hans im Glück nicht wie es im Märchen heißt der glücklichste, sondern der unglücklichste Mensch auf Erden.
Es bräuchte also wohl nicht nur frühe Bildung über die Effekte von Zins und Zinseszins, den Unterschied von real und nominal oder von Brutto und Netto. Dafür wäre ein Unterrichtsfach »Wirtschaft/Finanzen« sicher hilfreich. Angesichts der komplexen Interdependenz von Geldgier, Verdrängung, Scham und Achtungsverlust zwischen den Generationen sind aber wohl nicht nur die Ökonomen und Pädagogen, sondern auch die Psychologen gefordert.
Rainer Hank
05. Januar 2021
Amazon macht süchtig
Wie ich meinen Glauben an den Internethändler verlor
Seit Jahren zähle ich zu den treuesten Kunden von Amazon in Deutschland. Was habe ich dort nicht alles bestellt: Den Ersatzrost für unseren Backofen, die gesammelten Werke Hegels (unabdingbar im Jubiläumsjahr) oder Ersatzbatterien im Achterset für den Zündschlüssel meines Autos. Und, was soll ich sagen: Ich war immer zufrieden. Die Dinge werden im Netz übersichtlich präsentiert, die Bewertungen der Kunden sind aussagekräftig und die Lieferung erfolgt postwendend bis zu mir in den zweiten Stock, überreicht von ausschließlich freundlichen Mitarbeitern. Selbst die viel gescholtenen personalisierten Empfehlungen (»Kundinnen, die dieses Parfum kaufen, kaufen auch…«) fand ich stets einfühlsam und irgendwie meinen Geschmack treffend.
So habe ich mich in den vergangenen Jahren zu einem informellen Botschafter des kalifornischen Warenversenders im Frankfurter Nordend entwickelt, mannhaft mein Unternehmen verteidigt, wenn ich mir wieder einmal anhören musste, Amazon sei der Tod des Buchhandels, versklave seine Arbeiter und uniformiere den Konsum-Geschmack der Weltbevölkerung. Fast immer war ich in der Minderheit. Nichts hat mich aus der Kurve getragen, stets hatte ich – meiner Ansicht nach – ein schlagendes Gegenargument.
Doch jetzt ist es passiert. In diesen letzten Wochen des Jahres 2020 habe ich den Glauben an Amazon verloren.Und das kam so. Einige kurz hintereinander erfolgte Abbuchungen von Anfang November auf meiner Kreditkartenabrechnung, keine großen Beträge, kamen mir spanisch vor. Ich hatte die Befürchtung, ein Betrüger müsse mein Amazon-Konto gehackt haben. Solche Sachen liest man ja; warum sollte ich verschont bleiben. Ich bat meine Bank, das mutmaßlich betrügerisch abgebuchte Geld von Amazon zurückzufordern. Das funktionierte binnen eines Tages reibungslos. Tags darauf musste ich feststellen, dass es keinen Hacker gab, ich lediglich bei der coronabedingt vielfältigen Online-Bestellerei den Überblick über meine Käufe verloren hatte. So waren mir etwa die Fahrradhandschuhe für 10,97 Euro nicht mehr präsent. Mein Fehler, gewiss, ein Fehler freilich, den ich mir durchgehen lasse. Kann passieren.
Die Sache wird sich ziehen
Seither lerne ich Amazon von einer anderen Seite kennen. Wie naiv war es von mir zu meinen, die Sache lasse sich mit einer korrigierenden Mail an Amazon aus der Welt schaffen. Erst einmal reagierte das Unternehmen gar nicht, dann erhielt ich die Mitteilung, mein Amazon-Konto sei gesperrt, angeblich, um mich zu schützen. Einige Tage später wurde ich aufgefordert, um die Bestellungen zu bezahlen solle ich die Nummer einer Kreditkarte anzugeben, die aber nicht jene Kreditarte sein dürfe, von der ursprünglich die Beträge abgebucht worden seien, sie müsse aber gleichwohl auf meinem Amazon-Konto hinterlegt sein. Das werde schwierig, antwortet ich, denn es sei keine andere Kreditkarte hinterlegt, ich könne das aber jetzt gerne nachholen. Nein, das sei auch nicht möglich, wurde mir einige Tage später mitgeteilt. Da schwante mir, die Sache wird sich ziehen.
Ich kürze ab, aus Angst, Leser zu verwirren (oder zu langweilen). Amazon ächtet mich und schloss mich wochenlang aus der Community aus. Am anderen Ende der Telefon-Hotline traf ich zwar immer auf freundliche Call-Center-Mitarbeiterinnen, die stets versicherten, mein Anliegen weiterzugeben. Ohne Erfolg. Ich wäre bereit gewesen, das Geld persönlich mit Schufa-Zertifikat vorbei zu bringen oder in einem eingeschriebenen Umschlag an Jeff Bezos nach Seattle (Washington) zu schicken. Es nützte alles nichts. Wie Hohn kam es mir vor, dass die in nicht leicht zu verstehendem Deutsch formulierten Mails von »Kontospezialist. Amazon.de« mit dem Hinweis enden: »Unser Ziel: das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein. Ihr Feedback hilft uns dabei.«
Wechselaufwand für die Nutzer
Ich höre schon die Häme der Leser: Das kommt davon, wenn man sich auf Amazon verlässt. Und ich höre den Vorwurf: Hier wird ein einmaliger Vorfall, für dessen Eintreten ich auch noch selbst verantwortlich bin, generalisiert und zum Vertrauens-Super-Gau hochstilisiert. Diesen Verdacht zu entkräften half mir – wie stets – das F.A.Z.-Archiv. Dort findet sich genügend Material meiner Leidensgenossen, alle mit dem Tenor: Wehe dem, der den geschmierten Automatismus von Amazon stört. Der wird bestraft.
Als dilettierender Kartellexperte hätte ich vor diesem ärgerlichen Vorfall stets behauptet, Amazon sei nicht gefährlich trotz seiner inzwischen 80 Prozent Marktanteile im Online-Handel. Denn das Unternehmen nützt seine Macht ganz offensichtlich nicht aus, mir höhere Preise abzuknöpfen. Das immense Wachstum des Internetgiganten verdankt sich seiner auf Netzwerkeffekten beruhenden Leistung – mit freundlicher Unterstützung von der aktuellen Seuche, die es uns verbietet, beim stationären Händler einzukaufen. Doch jetzt sehe ich: Preissetzungsmacht ist nicht der einzige Schaden, den ein Monopolist den Menschen zufügt. Ich wurde Opfer einer Mischung aus Bürokratismus und Desinteresse am einzelnen Kunden. Der Monopolist braucht sich – allen Marketingsprüchen zum Trotz – nicht mehr besonders anstrengen, wird hochmütig und träge. Bei einem Rekordumsatz von hochgerechnet etwa 380 Milliarden Dollar im Jahr 2020 und einem Gewinn allein in den ersten drei Quartalen von 14 Milliarden Dollar kommt es auf den Kunden Hank nun wirklich nicht an. Abwandern wird er nicht, er hat ja keine Alternative.Hat er wirklich keine Alternative? Marktmacht, so lese ich im deutschen Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen Paragraph 18, Absatz 3a, sei auch im Hinblick auf den »Wechselaufwand für die Nutzer« zu überprüfen. Dazu könnte ich etwas beitragen. Der Wechselaufwand ist enorm. Denn einen vergleichbaren »Gatekeeper«, bei dem ich wie bei Amazon alles Mögliche bestellen kann, ohne mich jedes Mal durch komplexe Anmeldemenüs (samt Passwort-Wirrwarr) zu hangeln, gibt es nicht. Was habe ich in diesen Wochen an in meiner Not an Zeit und Nerven strapaziert. Bei den Büchern bin ich nach Frusterfahrungen mit Hugendubel schließlich bei Osiander gelandet – sehr zufrieden übrigens. Aber eim Tee oder dem Druckerpapier, stets geht die Registriererei wieder von vorne los.
Wie einfach ist es dagegen bei Amazon. Und genau das ist das Problem. Marktmacht ist verführerisch und bequem für den Kunden. Was mich an mir selbst irritiert: Ich habe mich in diesen Wochen richtig unglücklich gefühlt und offenbar zum ersten Mal mit Erschrecken realisiert, wie abhängig ich von Amazon schon geworden bin. Amazon macht süchtig?
Kann man ohne Amazon leben? Ja, man kann. Aber es ist anstrengend und muss ganz neu gelernt werden. Sagen wir es in den Worten der zuständigen EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Versager: »Wir sind an einem Punkt angekommen, wo die Macht der digitalen Unternehmen, insbesondere der größten Gatekeeper, unsere Freiheiten, unsere Chancen, sogar unsere Demokratie bedroht.« Nun gut, das mit der Demokratie ist – auf meinen Fall bezogen – vielleicht etwas übertrieben.
Postskriptum: Aus heiterem Himmel teilt mir Amazon am Tag vor Heiligabend mit, die »Angelegenheit« sei nun geklärt, es bestehe »kein Handlungsbedarf« mehr und ich werde wieder in die Gemeinschaft aufgenommen. Ob wir noch einmal Freunde werden?
Rainer Hank
28. Dezember 2020
Kein Betriebsunfall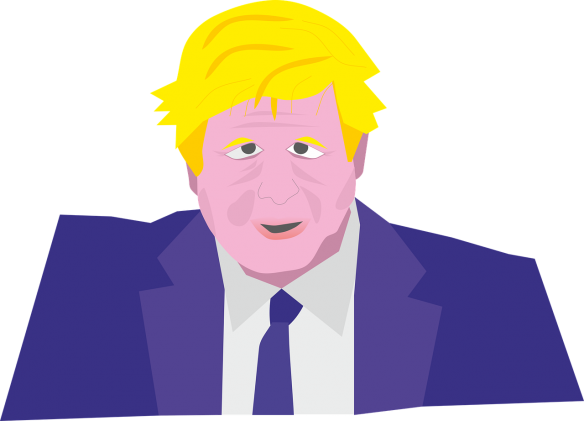
Was der Brexit mit uns Deutschen zu tun hat
Was geschah am 16. September 1992 in London? Hilft die Information, dass der Tag als »Schwarzer Mittwoch« in die Geschichte eingegangen ist? Bei mir fällt kein Groschen. Ich fürchte, in Deutschland geht das heute vielen Zeitgenossen so. Dabei gilt dieser Tag für die Briten als »die schwerste Demütigung seit Suez«. Die Suez-Krise 1956/57, dies erinnern wir aus der Serie »The Crown«, ist ein zentrales Datum des Niedergangs des britischen Empires.
Und der »Schwarze Mittwoch«? Am »Schwarzen Mittwoch« wurde England von der europäischen Gemeinschaft gezwungen, aus dem Europäischen Wechselkursmechanismus auszuscheiden, ein Vorfall, der technisch klingt, dem Land aber eine Abwertung seiner Währung und Verluste von rund 3,3 Milliarden Pfund bescherte. Die Zustimmung zur Regierung der Konservativen und zu Premierminister John Mayor schrumpfte von 42 auf 29 Prozent. Die Schuld für diese Demütigung gab man der Deutschen Bundesbank, die nicht bereit war, den Briten mit einer Zinssenkung zu Hilfe zu kommen und der Bundesregierung, die sich seit der Wiedervereinigung als verantwortungsloser Hegemon in Europa aufspielte. Der Spekulant George Soros hatte früh den richtigen Riecher und erfolgreich gegen das Pfund gewettet.
Aus der Geschichte des »Schwarzen Mittwochs« lässt sich einiges lernen. Zunächst dies, dass Traumata länger im kollektiven Gedächtnis haften bleiben als Siege. Damit könnte auch zusammenhängen, dass wir Deutschen große Schwierigkeiten haben, Verständnis für den Austritt der Briten aus der Europäischen Union aufzubringen. Vorwurfsvoll tönt es bis heute, wie man so töricht sein könne, aus falsch verstandenem Nationalstolz auf all die Segnungen der Europäischen Gemeinschaft zu verzichten. Konsequenterweise stößt die beleidigt-unnachgiebige Position Brüssels bei den Brexit-Verhandlungen bei uns auf große Zustimmung: Nachahmer Großbritanniens seien gewarnt!
Begleitlektüre zum Abschied der Briten
Der »Schwarze Mittwoch« war eine Wende; seither haben die Euroskeptiker in England Oberwasser. So lese ich es bei dem Politikwissenschaftler Vernon Bogdanor, einem Professor am King’s College in London. Dabei war es in den Jahren vor 1992 der britischen Regierung mühsam und nach zwei Referenden gelungen, für den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft im Jahr 1972 im Volk Rückhalt zu bekommen. Vernon Bogdanors gerade erschienenes Buch »Britannien und Europa in einer unruhigen Welt« (Yale University Press) empfiehlt sich als Begleitlektüre zum derzeit ablaufenden letzten Akt des Brexit. Für mich ist es eines der besten Europa-Bücher seit langem. Am Ende bringt der Leser viel Verständnis für den Brexit auf, obwohl oder gerade weil der Autor kein Brexiteer ist, sondern findet, sein Land hätte besser daran getan, in der EU zu bleiben.
Die These des Buches: Der Brexit ist kein Betriebsunfall der Geschichte, sondern Ergebnis eines gespannten Verhältnisses der Briten zum Kontinent, welches immer schon ambivalent war und ambivalent geblieben ist. Großbritannien hat sich dem Gemeinsamen Markt, der Europäischen Gemeinschaft und zuletzt der EU stets nur zögerlich beigesellt, den Euro gemieden und in den Jahrzehnten der EU-Mitgliedschaft sich nie vorbehaltlos nach Europa orientiert. Das hat viele Gründe und hängt zusammen mit der jahrhundertelangen Dominanz einer Seemacht über ein globales Imperium. Wer wollte sich da plötzlich von Frankreich oder Deutschland reinreden lassen? Sichtbar wird diese gefühlte Distanz in einer Radioansprache von Neville Chamberlain zum Münchner Abkommen 1938: Der Premier fand, es sei »unglaublich«, dass England gezwungen werde, sich um einen Konflikt, »in einem weit entfernten Land zwischen Völkern, von denen wir nichts wissen«, zu kümmern. Von London nach München sind es gut tausend Kilometer. Chamberlain hätte nicht so verständnislos geredet, wäre es um einen Konflikt in Sydney gegangen, eine Stadt, die von London über 10 000 Kilometer entfernt ist.
Trojanische Pferde aus der Büchse der Pandora
Es fehlte denn auch bei Labour wie bei Torys nie an gewichtigen Stimmen, die mahnten, sich der Vergemeinschaftung Europas zu widersetzen. Vernon Bogdanor zitiert den hübschen Ausspruch eines Labour-Politikers aus den späten vierziger Jahren: »Wer die Büchse der Pandora öffnet, kann nie wissen, welche trojanischen Pferde herausfliegen.« Es waren vor allem sehr konträre ökonomische Konzepte, die Festlandeuropäer und Briten mit der Gemeinschaft verbanden. Das begann mit der Landwirtschaft: Großbritannien profitierte von den günstigen Importen aus dem Commonwealth. Die eigene Landwirtschaft, nie wirklich systemrelevant, unterstützte man mit Steuermitteln. Frankreich und Deutschland hingegen garantierte ihrer Landwirtschaft feste Abnahmepreise. Der Unterschied ist erheblich: Einmal zahlen die Steuerzahler für die Landwirtschaft, das andere Mal die Verbraucher – zum Schaden der Importeure aus außereuropäischen Ländern. Das zeigt, dass die Europäische Gemeinschaft seit ihren Anfängen selbst ein ambivalentes Konstrukt ist – nach innen liberal, nach außen eine illiberale Festung.
Niemand hat diesen illiberalen Charakter der EU besser gesehen als Margaret Thatcher, die je älter umso europaskeptischer wurde. Habe am Ursprung der Gemeinschaft ein Programm wirtschaftlicher Freiheit für alle Mitglieder gestanden, so werde dies immer mehr unterlaufen von Vergemeinschaftungs-Aktonen der Geld- und Sozialpolitik, die den Marktmechanismus aushebeln. »Wir haben nicht bei uns erfolgreich den Staat geschrumpft, um uns am Ende einem von Brüssel dominierten europäischen Super-Staat zu unterwerfen«, sagte die Eiserne Lady in einer berühmten Europa-Vorlesung in Brügge 1988. Paradoxerweise trieben die Sozialisten im Königreich völlig entgegengesetzte Sorgen um: Während Thatcher Europa als marktfeindlich schalt, wähnte Labour die EU als marktliberales Projekt kalter Deregulierung und Privatisierung, welches ihrem Ziel einer sozialistischen Gesellschaft zuwiderlief. Die Vorbehalte könnten konträrer nicht sein, das Ergebnis ist identisch: Lasst uns auf der Insel mit der Europäischen Gemeinschaft in Ruhe. Ob nach dem Brexit das Königreich isolationistisch-protektionistisch oder womöglich doch wirtschaftlich offener dasteht als die EU (»Singapur an der Themse«), ist im Übrigen noch nicht entschieden.
Es war nicht erst die Finanz- und Flüchtlingskrise nach der Jahrtausendwende und erst recht nicht lediglich das Aufkommen eines irrationalen Populismus, welches die Brexit-Mehrheit des Referendums von 2016 erklärt. Die Briten hatten immer schon Gründe, sich in der EU unwohl zu fühlen. Vernon Bogdanor gibt den Völkern der EU den guten Rat, auch ihrerseits diese Sorgen ernst zu nehmen. Lernen ist besser als sich entrüsten. Was das heißt? Abschied nehmen vom Pathos einer »ever closer union« mit entsprechendem immer größerem Souveränitätsverlust für die Nationalstaaten unter einem supranationalen Brüsseler Regime. Besser wäre es, die EU als engen Verbund nationaler souveräner Regierungen weiterzuentwickeln. Es ist jedenfalls nicht alternativlos, die Sicherung des Völkerfriedens ausschließlich von den Vereinigten Staaten von Europa erzwingen zu wollen. Dass auch Vielvölkerstaaten am Ende kriegerisch scheitern können ist die Lehre von 1914 und die Botschaft aus dem Zerfall Jugoslawiens 1992.
Rainer Hank
21. Dezember 2020
Wozu Milliardäre gut sind
Sie halten in Corona-Zeiten den Laden am Laufen
Die Älteren werden sich noch an Friedrich von Bohlen und Halbach erinnern. Gut zwanzig Jahre ist das jetzt her. Bohlen, Spross der Krupp-Dynastie, war ein Star der sogenannten New Economy. »Lion Bioscience« hieß sein Unternehmen, das die moderne Informations- und Biotechnologie zusammenzubringen versprach. Wie das funktionieren sollte, hatten wir damals nicht so genau verstanden. Aber es waren aufregende Zeiten: Gerade hatte der amerikanische Forscher Craig Venter mit viel Bohei das menschliche Genom entschlüsselt, eine Erkenntnis mit mutmaßlich großem Potential für die medizinische und biotechnologische Forschung. Und Bohlen war sozusagen der Botschafter Venters in Deutschland.
Dass das alles ziemlich avantgardistisch war, hatte sich damals nicht nur in Berliner Intellektuellenkreisen, sondern bis in die Lehrerzimmer der Hinterpfalz herumgesprochen: Aktien des Neuen Marktes galten als schick und die Lion Bioscience-Aktie war der Renner bei jungen Leuten im eigentlich kapitalismusfeindlichen Deutschland. Dass Unternehmen Verluste machten, hielt die Leute nicht davon ab, Aktien zu kaufen, deren Kurs aufgrund hoher Nachfrage immer weiter nach oben kletterte. Man nannte das die Cash-Burn-Ratio: Je schneller ein Unternehmen Geld zu verbrennen verstand, als umso größer galt sein künftiges Gewinnpotential. Aus solchen schrägen Versprechen speiste sich die Hoffnung, mit der New Economy reich werden zu können und zugleich als Kleinaktionär ganz vorne auf der Lokomotive des gesellschaftlichen Fortschritts zu sitzen.
Die Sache ist dann, wie wir wissen, nicht gut gegangen. Nach der Jahrtausendwende brach der Neue Markt zusammen, was dazu beitrug, dass fortan Großeltern und Eltern ihre Kinder warnten, Aktien zu kaufen. Auch der Börsenkurs der Lion Bioscience AG stürzte vom Höchststand 106,50 Euro im September 2000 auf 2,95 Euro Ende 2002 ab. Ein Jahr später demissionierte Friedrich von Bohlen und Halbach. So hymnisch er zuvor gefeiert wurde, so laut war alsbald die Häme – Ausdruck des Leidens gebeutelter Aktionäre.
Das Team: Friedrich von Bohlen und Dietmar Hopp
Jetzt ist der Star von damals plötzlich wieder aufgetaucht: Vor kurzem hat er sich als Proband der Tübinger Firma Curevac zur Verfügung gestellt und sich gegen Corona impfen lassen. »Ein kleiner Piks, nicht schlimmer als bei einer Grippeimpfung«, erzählt Bohlen. Curevac, richtig, das ist neben der Mainzer Firma Biontech das zweite Unternehmen aus Deutschland, auf dem jetzt alle Hoffnungen einer raschen Beendigung der scheußlichen Pandemie ruhen.
Bohlen ist eng mit Curevac verbandelt, war nach der Niederlage mit Lion Bioscience nicht untätig. Einmal Unternehmer, immer Unternehmer. 2005 gründete er zusammen mit dem SAP-Erfinder und Fußball-Unternehmer Dietmar Hopp die Beteiligungsfirma Dievini, über die Hopp sein Engagement in Biotechnologie und Live Science steuert. Hopp machte Bohlen zum Geschäftsführer, schließlich hat er in Biochemie promoviert. Bis heute hat Hopp 1,4 Milliarden Euro aus seinem Privatvermögen in die Unternehmen gesteckt. Während eine ganze Reihe von Beteiligungen floppten, scheint sich Curevac zum neuen Star zu entwickeln: das Unternehmen ist inzwischen an der Börse knapp 18 Milliarden Euro wert.
Trifft man Bohlen heute, so erlebt man einen Mann, der mit deutlich weniger Anglizismen auskommt als früher, stolz ist auf seinen langen Atem – und das Engagement bei Curevac als eine Art nationale Mission versteht. Dievini, der Name bedeutet »Schutzgötter des Hauses« in der baltischen Mythologie, investiert strikt nur in deutsche Unternehmen. Wie Biontech hat auch Curevac früh das therapeutische Potential sogenannter Boten-RNA erkannt, mit welcher die menschlichen Zellen Informationen erhalten, wie sie im Körper Medikamente selbst herstellen können, die etwa zur Krebs- oder der Virusbekämpfung eingesetzt werden. Wenn Bohlen darüber redet, greift er zu Superlativen: Die Molekularbiologie spiele heutzutage für die Medizin dieselbe Rolle wie die Mathematik für die Physik. Endlich gebe es ein wissenschaftlich basiertes Verständnis von Krankheiten und deren Heilung.
Die Helden der Krise
Warum ich die Geschichte Friedrich von Bohlens erzähle? Weil man ihn – und erst recht Männer wie Dietmar Hopp oder die Strüngmann-Brüder, die Biontech finanzieren, – unbedingt mitaufnehmen muss in die Liste der Helden dieses Corona-Jahres. Man soll sie nicht gegeneinander ausspielen: Die Pflegekräfte, Rewe-Verkäuferinnen oder Müllmänner, die im Lockdown den Laden am Laufen halten. Aber man soll die pfiffigen Unternehmer und finanzierenden Milliardäre auch nicht vergessen. Hätte Deutschland erst im Sommer 2020 angefangen, über Corona-Impfstoffe zu forschen, hätten wir gleich einpacken können. Aber Curevac hat eben schon vor fünfzehn Jahren begonnen, die mRNA zu erkunden. Im Nachhinein sieht es wie eine konsequente Erfolgsgeschichte aus. Doch während der Mühen der Ebene weiß niemand, wie es ausgeht. Allzu viele Leute gibt es in Deutschland nicht, die in der Lage sind, mit 1,4 Milliarden Euro ins Risiko zu gehen und dabei in Kauf nehmen, alles in den Sand zu setzen, ohne am Ende auf Hartz IV angewiesen zu sein. Mutig sein ist leichter, wenn man früher irgendwo anders schon ein paar Milliarden verdient hat.
Bohlen insistiert mit Blick auf die eigene Geschichte darauf, dass Scheitern eine Bedingung des Erfolgs ist »Wenn Du nicht scheiterst, hast Du nicht genug gewagt.« Außerdem ist Bohlen der Meinung, dass seine dynastische Abkunft aus der berühmten Krupp-Familie ihm zugutekomme: »Ich denke schon, dass ich eine unternehmerische Veranlagung in mir trage«, sagte er jüngst in einem Gespräch mit dem Magazin Business Insider. Dazu gab es noch einen kleinen wirtschaftshistorischen Exkurs zur eigenen Familiengeschichte: Weiß man zu Beginn eines Investments, ob es klappt? Nein. »Wir haben bei Dievini auch einige Investments abschreiben müssen.« Es läuft ungefähr wie damals beim Stahl der Krupps, soll das heißen. »1790 hätte Stahl keine Chance gehabt. 1840 war Stahl das zentrale Thema, weil die Eisenbahn so viel Nachfrage generierte. »Wer 1830 keinen Stahl beherrschte, kam zu spät.« Das ist die wirtschaftshistorische Analogie zur heutigen Impfstoff-Kompetenz bei Biontech, Moderna oder eben Curevac. Ach ja, dass Berthold Beitz Thyssen-Krupp schändlich heruntergewirtschaftet habe, muss Bohlen beiläufig natürlich auch noch erwähnen.
Es ist eine lange Geschichte vom Aufstieg und Fall von Lion Bioscience bis zum Triumph von Curevac, wo – nur zur Erinnerung – wir Steuerzahler über ein 300–Millionen-Investment von Minister Altmaier Miteigentümer sind – bislang übrigens, anders als bei der Commerzbank, nicht zu unserem Schaden.
Aber was ist eigentlich aus Lion Bioscience geworden? Google liefert hier keine Auskunft. Aber die Archivrecherche der F.A.Z. ergibt: Das Unternehmen lebt noch, inzwischen unter dem Namen »4basebio AG«. Geschäftstätigkeit: Erforschung und Entwicklung von innovativen Therapien zur Behandlung von Erkrankungen des Zentralen Nervensystems. Hauptgesellschafter: Professor von Bohlen und Halbach, Friedrich, mit vier Prozent. Dievini Hopp Biotech AG mit 54,5 Prozent. BASF mit elf Prozent. Bayer: drei Prozent. Na dann: Viel Erfolg!
Rainer Hank
15. Dezember 2020
Corona verdirbt die Sitten
Schleichend gewöhnen wir uns alle ans Staatsgeld
Je länger die Pandemie dauert, umso größer werden auch die von ihr angerichteten Kollateralschäden. Dass sich Bürger in der Not kollektiv solidarisch verhielten, hat sich als Illusion erwiesen, womit die vielen positiven Beispiele individuell karitativer Zuwendung nicht geschmälert werden sollen. Nachdem aber dem »Lockdown light« eine Logik der Verhältnismäßigkeit fehlt – die einen dürfen, die anderen dürfen nicht -, wurde ein Kompensationswettlauf diverser Opfergruppen um fiskalische Entschädigung für die ungerechtfertigten Freiheitsbeschränkungen losgetreten. Anstelle des Lohns gibt es Kurzarbeitergeld. Anstelle am Markt erwirtschafteter Einkommen gibt es November- und Dezembergeld. Das wird im kommenden Jahr so weitergehen, auch wenn die Berechnungsgrundlagen sind ändern. Die Kanzlerin sagt, man könne nicht bis zum Ultimo zahlen – sie meint, nicht bis zum jüngsten Tag. Das heißt umgekehrt: Staatsgeld wird es noch eine ganze Weile geben.
Ich will gar nicht bestreiten, dass staatliche Kompensationen für Corona-Schäden in dieser vermaledeiten Krise gerechtfertigt sind. Ich will auf die unbeabsichtigten Konsequenzen hinweisen, die verheerend sind: Corona verdirbt die Sitten. Und zwar schleichend. Wir alle bekommen mehr und mehr das Gefühl, in einer Gratiswelt zu leben. Kommt das Geld nicht von der Firma, dann kommt es halt vom Staat. Wer sich übergangen fühlt, muss nur laut genug schreien, dann kommt Frau Grütters oder Herr Altmaier alimentierend und strukturkonservierend vorbei. Die Corona-Opfer (ob Restaurantbesitzer oder Singer-Songwriter) machen jetzt häufig geltend, sie hätten doch in guten Zeiten viele Steuern bezahlt, woraus sich ein Anrecht begründe, in der Not etwas zurück zu bekommen. Es nistet sich das Missverständnis ein, Steuern zahle man als eine Art Sozialversicherung für kollektive Schicksalsschläge. Dabei gibt es bei Steuern gerade kein Äquivalenzprinzip. Steuern sind dazu da, öffentliche Leistungen zu finanzieren und Geld von den Reichen zu den Bedürftigen umzuverteilen.
Dass gerade jetzt die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens viele neue Freunde findet, verwundert nicht. Das wäre die Verstetigung der Corona-Hilfen in künftig seuchenfreie Friedenszeiten. Beunruhigend ist, dass das von einem parteiübergreifenden Bündnis kommt. Bei den Grünen, demnächst Koalitionspartner einer Bundesregierung, steht das Grundeinkommen sogar im Parteiprogramm. Die FDP liebäugelt schon lange damit, auch die AfD hegt große Sympathien. Dass Union und SPD nennenswerten Widerstand leisten werden, ist kaum zu erwarten: Wer will schon den Bürgern Gratiszahlungen vorenthalten? Auch die Eliten – von Richard David Precht bis Elon Musk – schwärmen vom bedingungslosen Grundeinkommen. Gemeinsam vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und dem Verein »Mein Grundeinkommen« gestartete Feldversuche sollen beweisen, dass erst so das Sicherheitsversprechen des Rechtsstaats (nachhaltig, gerecht, sozial ausgeglichen) eingelöst werde. Psychologen und Mediziner sekundieren: Das Grundeinkommen mache die Menschen gesünder, glücklicher und kreativer. Na dann!
Wenn Staatsverschuldung sich selbst finanziert
Einziger Haken einer dauerhaften und bedingungslosen Staatsalimentierung ist bislang seine Finanzierbarkeit. Irgendjemand muss schließlich den Bürgern ihr Gratiseinkommen verdienen: dafür bieten sich die Leistungseliten an, die hohe Einkommen und hohe Vermögen besitzen, wovon sie hohe Steuern zahlen können, die anschließendS an die Allgemeinheit bedingungslos umverteilt würden. Doch ob selbst nach drastischen Steuererhöhungen genügend Geld da wäre, ist fraglich: Gute Idee, aber schwer zu finanzieren, so lautete in der Regel der Zwischenstand zur Grundeinkommensidee.
Doch das könnte sich jetzt ändern. Das Zauberwort heißt Staatsverschuldung. Da setzt sich mehr und mehr selbst bei klugen Ökonomen der Glaube durch, ein Leben auf Pump sei unproblematisch, Schulden müssten nicht wie ein normaler Baukredit irgendwann zurückgezahlt werden, sondern verschwänden eines Tages ganz von selbst. So stellt man sich das Schlaraffenland vor: Von nun an bekommt jedermann ohne Bedürftigkeitsprüfung sein Lebtag lang ein garantiertes Monatseinkommen (1000 bis 1200 Euro sind im Gespräch), ohne dass dies irgendjemandem weh tut.
Über die Idee der sich selbst tilgenden Schulden habe ich am vergangenen Sonntag in dieser Kolumne geschrieben. Kurz gesagt, funktioniert es so: Die Realzinsen sind schon seit geraumer Zeit leicht negativ. Demgegenüber ist das Wachstum entwickelter Volkswirtschaften moderat positiv. Sofern der Zins, den die Staaten für ihre Schulden zahlen, auch auf längere Sicht niedriger bleibt als das jährliche Wachstum, verschwinden die Staatschulden von selbst: Die Schuldenquote schmilzt dahin; wir wachsen aus den Schulden raus. Ein Wunder, dass die Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens diese Selbstfinanzierungschancen bislang nicht als ihren stärksten Trumpf entdeckt haben.
Das Schlaraffenland als Verhängnis
Ob die Rechnung aufgeht? Man weiß leider so wenig über die Zukunft (siehe Corona). Ginge sie aber auf, wäre das aus meiner Sicht verheerend (siehe Sittenverderbnis). Warum die Rechnung riskant ist, hat der Harvard-Ökonom Gregory Mankiw vor ein paar Tagen in der New York Times gezeigt. Dass die Zinsen seit geraumer Zeit so niedrig sind, könnte nämlich daran liegen, dass den Unternehmen nichts mehr einfällt, wie und wo sie investieren könnten. Niedrigzinsen spiegeln niedrige Wachstumserwartungen, so Mankiw: Hätte er Recht, hätten wir die Differenz zwischen Zins und Wachstum als Enschuldungsvehikel zu positiv interpretiert. Es wäre keine frohe Verheißung des Schlaraffenlands, sondern gefährliches Signal ausbleibenden Wachstums, womit exakt jene Idee der wundersamen Schuldentilgung gefährdet wäre, die ja gerade auf stetiges Wachstum setzen muss. Wie schnell die Weltwirtschaft sich nach Corona erholen wird und ob die Gläubiger der Staatsschulden gelassen immer bleiben, kann niemand sagen. Und wo dann schon wieder die nächste Krise lauert, wissen wir auch nicht; der Krisenzyklus ist seit der Finanzkrise immer kürzer.
Dabei ist es ein besonderer Witz, dass viele Freunde des Grundeinkommens zugleich auch Freunde der modischen Schrumpfungs-Theorien (»Degrowth«) sind. Sie schwärmen vom einfachen Leben jenseits der Logik von Wachstum und Konsums und verteufeln damit genau jene Bedingungen (Wachstum!), die sie zur automatischen Finanzierung ihres Grundeinkommens dringend bräuchten.
Doch nehmen wir an, die Rechnung geht auf wir leben nach Corona alle im sich selbst finanzierenden Schlaraffenland? Dann sollten wir uns zweimal überlegen, ob wir das wollen. Guy Kirsch, ein Ökonom aus Luxemburg, hat vor einigen Jahren in der F.A.S. in einer brillanten Bildinterpretation von Pieter Brueghels »Schlaraffenland« gezeigt: Glück gibt es für uns Menschen nur als Lohn für Fleiß und Entbehrung. Im gratis gereichten Überfluss verlieren die Menschen den Sinn für Genuss. Schnell stellt sich Überdruss am Überfluss ein. Das Schlaraffenland der Staatsalimentierung bis zum Ultimo – es wäre ein von Corona bewirktes Verhängnis.
Rainer Hank
