Hanks Welt
‹ alle Artikel anzeigen28. Dezember 2020
Kein Betriebsunfall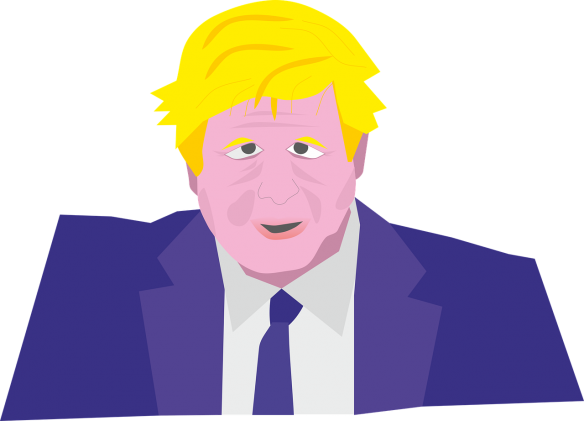
Was der Brexit mit uns Deutschen zu tun hat
Was geschah am 16. September 1992 in London? Hilft die Information, dass der Tag als »Schwarzer Mittwoch« in die Geschichte eingegangen ist? Bei mir fällt kein Groschen. Ich fürchte, in Deutschland geht das heute vielen Zeitgenossen so. Dabei gilt dieser Tag für die Briten als »die schwerste Demütigung seit Suez«. Die Suez-Krise 1956/57, dies erinnern wir aus der Serie »The Crown«, ist ein zentrales Datum des Niedergangs des britischen Empires.
Und der »Schwarze Mittwoch«? Am »Schwarzen Mittwoch« wurde England von der europäischen Gemeinschaft gezwungen, aus dem Europäischen Wechselkursmechanismus auszuscheiden, ein Vorfall, der technisch klingt, dem Land aber eine Abwertung seiner Währung und Verluste von rund 3,3 Milliarden Pfund bescherte. Die Zustimmung zur Regierung der Konservativen und zu Premierminister John Mayor schrumpfte von 42 auf 29 Prozent. Die Schuld für diese Demütigung gab man der Deutschen Bundesbank, die nicht bereit war, den Briten mit einer Zinssenkung zu Hilfe zu kommen und der Bundesregierung, die sich seit der Wiedervereinigung als verantwortungsloser Hegemon in Europa aufspielte. Der Spekulant George Soros hatte früh den richtigen Riecher und erfolgreich gegen das Pfund gewettet.
Aus der Geschichte des »Schwarzen Mittwochs« lässt sich einiges lernen. Zunächst dies, dass Traumata länger im kollektiven Gedächtnis haften bleiben als Siege. Damit könnte auch zusammenhängen, dass wir Deutschen große Schwierigkeiten haben, Verständnis für den Austritt der Briten aus der Europäischen Union aufzubringen. Vorwurfsvoll tönt es bis heute, wie man so töricht sein könne, aus falsch verstandenem Nationalstolz auf all die Segnungen der Europäischen Gemeinschaft zu verzichten. Konsequenterweise stößt die beleidigt-unnachgiebige Position Brüssels bei den Brexit-Verhandlungen bei uns auf große Zustimmung: Nachahmer Großbritanniens seien gewarnt!
Begleitlektüre zum Abschied der Briten
Der »Schwarze Mittwoch« war eine Wende; seither haben die Euroskeptiker in England Oberwasser. So lese ich es bei dem Politikwissenschaftler Vernon Bogdanor, einem Professor am King’s College in London. Dabei war es in den Jahren vor 1992 der britischen Regierung mühsam und nach zwei Referenden gelungen, für den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft im Jahr 1972 im Volk Rückhalt zu bekommen. Vernon Bogdanors gerade erschienenes Buch »Britannien und Europa in einer unruhigen Welt« (Yale University Press) empfiehlt sich als Begleitlektüre zum derzeit ablaufenden letzten Akt des Brexit. Für mich ist es eines der besten Europa-Bücher seit langem. Am Ende bringt der Leser viel Verständnis für den Brexit auf, obwohl oder gerade weil der Autor kein Brexiteer ist, sondern findet, sein Land hätte besser daran getan, in der EU zu bleiben.
Die These des Buches: Der Brexit ist kein Betriebsunfall der Geschichte, sondern Ergebnis eines gespannten Verhältnisses der Briten zum Kontinent, welches immer schon ambivalent war und ambivalent geblieben ist. Großbritannien hat sich dem Gemeinsamen Markt, der Europäischen Gemeinschaft und zuletzt der EU stets nur zögerlich beigesellt, den Euro gemieden und in den Jahrzehnten der EU-Mitgliedschaft sich nie vorbehaltlos nach Europa orientiert. Das hat viele Gründe und hängt zusammen mit der jahrhundertelangen Dominanz einer Seemacht über ein globales Imperium. Wer wollte sich da plötzlich von Frankreich oder Deutschland reinreden lassen? Sichtbar wird diese gefühlte Distanz in einer Radioansprache von Neville Chamberlain zum Münchner Abkommen 1938: Der Premier fand, es sei »unglaublich«, dass England gezwungen werde, sich um einen Konflikt, »in einem weit entfernten Land zwischen Völkern, von denen wir nichts wissen«, zu kümmern. Von London nach München sind es gut tausend Kilometer. Chamberlain hätte nicht so verständnislos geredet, wäre es um einen Konflikt in Sydney gegangen, eine Stadt, die von London über 10 000 Kilometer entfernt ist.
Trojanische Pferde aus der Büchse der Pandora
Es fehlte denn auch bei Labour wie bei Torys nie an gewichtigen Stimmen, die mahnten, sich der Vergemeinschaftung Europas zu widersetzen. Vernon Bogdanor zitiert den hübschen Ausspruch eines Labour-Politikers aus den späten vierziger Jahren: »Wer die Büchse der Pandora öffnet, kann nie wissen, welche trojanischen Pferde herausfliegen.« Es waren vor allem sehr konträre ökonomische Konzepte, die Festlandeuropäer und Briten mit der Gemeinschaft verbanden. Das begann mit der Landwirtschaft: Großbritannien profitierte von den günstigen Importen aus dem Commonwealth. Die eigene Landwirtschaft, nie wirklich systemrelevant, unterstützte man mit Steuermitteln. Frankreich und Deutschland hingegen garantierte ihrer Landwirtschaft feste Abnahmepreise. Der Unterschied ist erheblich: Einmal zahlen die Steuerzahler für die Landwirtschaft, das andere Mal die Verbraucher – zum Schaden der Importeure aus außereuropäischen Ländern. Das zeigt, dass die Europäische Gemeinschaft seit ihren Anfängen selbst ein ambivalentes Konstrukt ist – nach innen liberal, nach außen eine illiberale Festung.
Niemand hat diesen illiberalen Charakter der EU besser gesehen als Margaret Thatcher, die je älter umso europaskeptischer wurde. Habe am Ursprung der Gemeinschaft ein Programm wirtschaftlicher Freiheit für alle Mitglieder gestanden, so werde dies immer mehr unterlaufen von Vergemeinschaftungs-Aktonen der Geld- und Sozialpolitik, die den Marktmechanismus aushebeln. »Wir haben nicht bei uns erfolgreich den Staat geschrumpft, um uns am Ende einem von Brüssel dominierten europäischen Super-Staat zu unterwerfen«, sagte die Eiserne Lady in einer berühmten Europa-Vorlesung in Brügge 1988. Paradoxerweise trieben die Sozialisten im Königreich völlig entgegengesetzte Sorgen um: Während Thatcher Europa als marktfeindlich schalt, wähnte Labour die EU als marktliberales Projekt kalter Deregulierung und Privatisierung, welches ihrem Ziel einer sozialistischen Gesellschaft zuwiderlief. Die Vorbehalte könnten konträrer nicht sein, das Ergebnis ist identisch: Lasst uns auf der Insel mit der Europäischen Gemeinschaft in Ruhe. Ob nach dem Brexit das Königreich isolationistisch-protektionistisch oder womöglich doch wirtschaftlich offener dasteht als die EU (»Singapur an der Themse«), ist im Übrigen noch nicht entschieden.
Es war nicht erst die Finanz- und Flüchtlingskrise nach der Jahrtausendwende und erst recht nicht lediglich das Aufkommen eines irrationalen Populismus, welches die Brexit-Mehrheit des Referendums von 2016 erklärt. Die Briten hatten immer schon Gründe, sich in der EU unwohl zu fühlen. Vernon Bogdanor gibt den Völkern der EU den guten Rat, auch ihrerseits diese Sorgen ernst zu nehmen. Lernen ist besser als sich entrüsten. Was das heißt? Abschied nehmen vom Pathos einer »ever closer union« mit entsprechendem immer größerem Souveränitätsverlust für die Nationalstaaten unter einem supranationalen Brüsseler Regime. Besser wäre es, die EU als engen Verbund nationaler souveräner Regierungen weiterzuentwickeln. Es ist jedenfalls nicht alternativlos, die Sicherung des Völkerfriedens ausschließlich von den Vereinigten Staaten von Europa erzwingen zu wollen. Dass auch Vielvölkerstaaten am Ende kriegerisch scheitern können ist die Lehre von 1914 und die Botschaft aus dem Zerfall Jugoslawiens 1992.
Rainer Hank
