Hanks Welt
Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).
Aktuelle Einträge
25. Juni 2025Vom New Deal zum Real Deal
08. Juni 2025Geld her!
27. Mai 2025Wer stoppt Trump?
10. Mai 2025Ein Herz aus Stammzellen
14. April 2025Lauter Opportunisten
07. April 2025Die Ordnung der Liebe
29. März 2025Streicht das Elterngeld
17. März 2025Der Kündigungsagent
17. März 2025Hart arbeiten, früh aufstehen
04. März 2025Kriegswirtschaft
15. Oktober 2019
Diktat der Populisten
Wir sollten den Klimawandel nicht den Angstmachern überlassen
»Extinction Rebellion« heißt der neueste Zweig der Protestbewegung gegen den Klimawandel. »Extinction Rebellion«, bedeutet: Aufstand gegen das Aussterben der Gattung. Die Protagonisten rufen zum »massenhaften zivilen Ungehorsam« auf. Mit Kinderwagen und Babytragetüchern an vorderster Protest-Front geht es – quasi in letzter Minute – um die Rettung der Menschheit vor ihrem Untergang. »Mich betrifft es ja nicht mehr, wenn die Welt untergeht«, sagt ein mitdemonstrierender Rentner: »Aber die Sorge für meine Nachkommen mache ich durch Aktivismus wett.«
Das Ende der Welt ist nahe. Immer stärker ist dieser apokalyptische Ton in den Protesten der Klimaaktivisten zu vernehmen. Das zugrundeliegende Ängstigungs-Schema geht in etwa so: Es ist fünf vor Zwölf. Wenn in diesen letzten fünf Minuten nichts passiert, müssen unsere Kinder erleben, wie die Welt untergeht. Die Erde erwärmt sich, der Meeresspiegel hebt sich. Was danach kommt, erlebt kein Mensch mehr. Die Dramatik der Naherwartung des Untergangs rechtfertigt ungewöhnliche Maßnahmen zu seiner Vermeidung. »Wenn es irgendwann einen grün gefärbten Notstandsstaat geben sollte, dann, weil die Klimakrise so dramatisch geworden ist, dass sie anders nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden kann«, schreibt der Öko-Aktivist Bernd Ulrich: »Die Ökodiktatur verdankte sich dann nicht einem politischen Sieg der Ökologen, sondern deren Niederlagen und dem aggressiven Attentismus ihrer Kritiker, nicht aus ökologischer Ideologie, sondern ökologischen Unterlassungen.« Mit anderen Worten: Das drohende Endspiel der Geschichte rechtfertigt eine Notstandsverfassung, welche die demokratischen Grundrechte außer Kraft setzt (»Diktatur«). Schuld an diesen Maßnahmen tragen nicht etwa die ökologisch motivierten Putschisten, die diese Ermächtigungsgesetze erlassen werden, sondern alle übrigen Menschen bösen Willens, die verhindern, dass die Klimafreunde ihr Rettungsprogramm durchsetzen können.
Naherwartung setzt den Normalzustand außer Kraft
Gegen eine deutsche »Notstandsverfassung« sind wir in den sechziger Jahren auf die Straße gegangen, weil wir Sorge hatten, diese könne zum Einfallstor für die Wiederkehr des Faschismus werden. Auch die Kommunisten haben die Notwendigkeit eines Schreckensregimes stets den Anti-Kommunisten in die Schuhe geschoben, die dem Weg zum klassenlosen Paradies Steine in den Weg legen. Als klimafreundliche Ökodiktatur zur Verhinderung des Weltuntergangs findet eine solche Notstandsverfassung heute viele Unterstützer. Das ist nichts anderes als purer Populismus, vorgetragen von Leuten, deren Selbstverständnis ein elitäres, ganz und gar nicht populistisches ist.
Wir sollten den Klimawandel nicht den Apokalyptikern überlassen. Sie handeln nach dem Motto, der gute Zwecke heilige am Ende die öko-diktatorischen Mittel, die der Gegner leider ihnen aufgezwungen habe. Naherwartung setzt den Normalzustand außer Kraft. Wir sollen unser gesamtes Leben ändern (essen, reisen, wohnen). Wer dazu nicht aus freien Stücken bereit ist, wird gezwungen. Schließlich, wie gesagt, ist es fünf vor zwölf.
In Wirklichkeit nützen die Apokalyptiker dem Klima nicht, sie schaden ihm. Denn die kritische Frage an alle Weltuntergangspropheten lautet: Was ist, wenn das Ende der Welt nicht eintritt, zumindest nicht zu dem erwarteten Termin? Gewiss, bei den Aktivisten der Naherwartung ist dieser Fall gar nicht vorgesehen, sie glauben ja an den drohenden Weltuntergang. Bloß dass in der bisherigen Geschichte der Menschheit empirisch ihr Ende noch nicht vorgekommen ist. Das Stichwort dafür heißt »Parusie-Verzögerung«, eine Erfahrung des frühen Christentums. Die Jünger Jesu gingen davon aus, dass es nur noch eine kleine Weile dauere, bis der Erlöser wiederkehren werde, die Welt zu richten: »Noch in dieser Generation wird das alles geschehen«, heißt es im Neuen Testament: Mit dem Aufzug wilder Tiere und Monster, mit Feuer, Sturm und Wasser würde das Irdische vergehen. Alles Handeln sollte auf die Wiederkunft Christi ausgerichtet werden. Denn das Normale relativiert sich angesichts des nahenden Endes der Welt.
Was passiert, wenn der Weltuntergang ausbleibt?
Nachdem es dann anders gekommen ist, war der Katzenjammer groß. Die einen fielen vom Glauben ab. Die anderen waren resignativ genötigt, sich mit den Verhältnissen zu arrangieren. »Jesus verkündete das Reich Gottes – und gekommen ist die Kirche«, so lautete der bissige Satz des Modernisten-Theologen Alfred Loisy (1857 bis 1940); die Kirche hat ihn dafür exkommuniziert. Das erinnert an einen Sketch des britischen Comedians Peter Cook über »The End of the World«, ein Stück, welches als Durchbruch des satirischen Humors in den frühen sechziger Jahren im Londoner Westend gilt (kann man auf Youtube anhören): Peter hat sich mit einigen Getreuen auf der Spitze eines hohen Berges eigerichtet, weil ihn dies der einzig sichere Ort auf der Welt dünkt, wenn die apokalyptischen Stürme und Überschwemmungen erst einmal losgegangen sein werden. Als sein Freund ihn fragt, wann es denn nun soweit sei, gibt er der Welt gerade noch 30 Sekunden Zeit, in der sich die beiden mutmaßlich einzig Überlebenden darum kümmern, ob sie auch genügend Dosennahrung inklusive – »noch zehn Sekunden!« – einem Dosenöffner bei sich haben. Doch der Weltuntergang lässt auf sich warten, womöglich, wähnt Peter, habe er sich vertan, weil die Apokalypse gar nicht in »Greenwich Mean Time« WEZ vorhergesagt wurde. »Lass uns einfach morgen noch einmal darauf warten – same time«, so endet der Sketch.
Die Satire zeigt: Apokalyptische Naherwartungen sind eine Spielform des Eskapismus. Die an die Wand gemalten Höllenhunde sollen die Menschen in »Panik« versetzen (Greta Thunberg), alles vorgetragen mit einem Schuss vorweggenommener Vergeblichkeit, um umso stärker Wehklage über die Verstocktheit der Menschheit üben zu können. Ausgespart wird die Frage, was zu tun ist, wenn der Weltuntergang nicht eingetreten sein wird. Angst machen reicht dann nicht mehr.
Gibt es Wege, das Klima zu retten, die nicht gleich dem Vorwurf des Attentismus verfallen? Ja, die gibt es. Es sind die Mühen der Ebene, die der Philosoph Karl Popper als »Politik der kleinen Schritte« (piecemeal engineering) bezeichnet hat. Seine erste Voraussetzung heißt: Die Welt wird nicht untergehen. Ist angesichts der großen Bedrohung eine Politik der kleinen Schritte nicht zynisch? Nein. Nötig – und vielfach von Ökonomen vorgetragen – wäre vor allem ein institutionelles Arrangement, welches der Preisbildung auf den Märkten vertraut, welche ausgelöst wird durch politische CO2 -Mengenvorgaben. Das wäre eine marktkonforme, also nicht-dikatorische Lösung, ein Emissionshandel mit CO2–Zertifikaten. Er setzt auf Anreize zur Vermeidung von Treibhausgasen und kommt ohne apokalyptische Reiter aus. Neben solchen Anreizen braucht es parallel Maßnahmen der Anpassung der Welt an den unabwendbaren Klimawandel. Dazu gehört zum Beispiel: Dämme bauen oder bessere Klimaanlagen erfinden. Dass die Apokalyptiker solch adaptive Strategien nicht in den Blick bekommen, ist sträflich, aber verständlich: Sie erwarten ja den Untergang der Welt. An den Weltuntergang kann man sich nicht anpassen. Wir sollten aus ökologischen Gründen den Untergangspropheten das Monopol auf die Sorge um unsere Umwelt streitig machen.
Rainer Hank
08. Oktober 2019
Kunst-Kapitalismus
Wie kann ein Gemälde 450 Millionen Dollar wert sein?
Paris bereitet sich auf Leonardo da Vinci vor. Vom 24. Oktober an wird im Louvre eine Gesamtschau des »genialen Künstlers mit den vielen Talenten« zu sehen sein, wie es in der Werbung dafür heißt.
Doch der teuerste Leonardo, wird in der Ausstellung nicht zu bewundern sein. Nein, es handelt sich nicht um die Mona Lisa, – die ist ja schon im Louvre. Es dreht sich um ein Gemälde mit dem Titel »Salvator Mundi«, welches Jesus mit verklärtem Blick als Erlöser der Welt und Herrscher über den Kosmos zeigt. »Salvator Mundi« ist nicht nur der teuerste Leonardo, es ist sogar das weltweit teuerste Gemälde überhaupt, für das zuletzt im November 2017 der schwindelerregende Preis von 450 Millionen Dollar gezahlt wurde – obwohl die Gelehrten streiten, ob es überhaupt von Leonardo stammt. Doch niemand weiß genau, wo sich das Gemälde derzeit aufhält.
Kann ein einziges Gemälde 450 Millionen Dollar wert sein, dessen Provenienz noch dazu zweifelhaft ist? Auf dem Kunstmarkt herrschen eben eigene Gesetze, heißt es gerne. Ich will hier eine entgegensetzte These vertreten: Der Kunstmarkt ist quasi die Urform der Marktwirtschaft.
Für alle, die die Geschichte von »Salvator Mundi« nicht mitbekommen haben – eine Geschichte, die das Zeug zum großen Thriller oder zum Märchen aus Tausendundeiner Nacht hat – hier eine Zusammenfassung: Alles beginnt am 5. März 2008, als dem Oxford-Kunsthistoriker und Leonardo-Spezialisten Martin Kemp das Gemälde eines bislang unbedeutenden alter Meisters gezeigt wird. Kemp ist elektrisiert, sagt später, er habe sich gefühlt »wie in der Gegenwart der Mona Lisa«, und ist sich alsbald sicher, dass es sich um ein Original von Leonardo handelt.Schillernde Kunstberater und gierige Oligarchen
Die »Entdeckung« eines Leonardos wirkt als Ausweitung des Angebots auf einem starren Markt. Das gierige Geld der Reichen braucht sozusagen Frischfleisch. Postwendend ging der Preis durch die Decke. Im Jahr 1956 war »Salvator Mundi« noch für 45 britische Pfund zu haben. Doch schon im Jahr 2013 musste ein schillernder Kunstberater und Händler in Genf dafür 80 Millionen auf den Tisch legen, was freilich nicht zu seinem Schaden war, denn er drehte es alsbald einem russischen Oligarchen und Sammler mit einem kleinen Aufpreis für 127,5 Millionen Dollar an. Nicht schlecht: Ein Gewinn von 50 Millionen Dollar mit einem einzigen Produkt und ohne viel Arbeit. Seit der Oligarch von dieser märchenhaften Marge seines Beraters Wind bekommen hat, sind die Herren nicht mehr so gut befreundet.
Doch auch der Oligarch brauchte sich nicht zu beklagen, als er vier Jahre später beschloss, das Werk bei Christie’s versteigern zu lassen. Ein saudischer Prinz war bereit, die schon genannte Summe von 450 Millionen Dollar zu bezahlen. Danach verwischen sich die Spuren: Heute soll es im Besitz des Kronprinzen von Abu Dhabi sein, der es im letzten Herbst feierlich in seinem dortigen Louvre-Ableger präsentieren wollte. Dazu ist es nicht gekommen.
Gesehen hat das Bild schon lange niemand mehr. Es soll sich in einem sogenannten Freihafen in Genf befinden. Diese Zollfreilager sind aufregende Paläste des globalen Kunst-Kapitalismus, für den gemeinen Mann unzugängliche Museen der Super-Reichen. Ursprünglich waren sie für den Transithandel gedacht. Heute sind es Lagerhäuser, in denen Güter aufbewahrt werden, ohne dass Zollgebühren oder Mehrwertsteuern bezahlt werden müssen. Oft werden Kunstwerke dort jahrelang eingelagert, wobei sie mehrmals den Besitzer wechseln. Wie viele hunderte Millionen Dollar an Wert sich da summieren, weiß niemand.
Das Kunstwerkt hat sich heute zu einer Art Immobilie gewandelt. Es kann im Lager bleiben, mehrfach den Besitzer wechseln, ohne dass Zölle oder Steuern anfallen. Das Geschäft ist anonym und intransparent: es genügt, wenn die Abgesandten des Deals – meist Anwälte – sich einigen. Es gibt ernste Überlegungen, den Kunstmarkt wie den Aktienmarkt zu organisieren: Dann könnte man Leonardos »Salvator Mundi« sogar in tausend virtuelle Teile – sogenannte Token – stückeln: und man wäre schon mit 450000 Dollar ein kleiner Mitbesitzer. Das beweist: Das Kunstwerkt ist inzwischen ein reinrassiges kapitalistisches Handelsgut.
Der Kunstmarkt als Urform der Marktwirtschaft
Gibt es denn neben dem Marktwert nicht auch noch einen immateriellen Wert eines Bildes? So argumentieren jene Kunstrichter, deren normatives Wertungsmonopol der schnöde Tauschwert konterkariert. Daran ist zumindest richtig, dass das Kunstwerk ein Janusgesicht hat, vergleichbar einer teuren Flasche Wein, einem Unternehmen, einem Batzen Gold oder eben einer Immobilie. All diese Güterklassen dienen neben der Geldanlage auch noch einem weiteren Zweck: Wein kann man »liquidieren«, wonach freilich der ganze schöne Bordeaux nichts mehr wert ist. Gold lässt sich als Diadem tragen. In einer Immobilie kann man wohnen, in einer Fabrik arbeiten. Überall gibt es Shareholder, die Eigentümer, und Stakeholder, die mit den Wertgegenständen noch anderes im Sinn haben, was Raum für vielfältige Konflikte eröffnet.
Mehr noch: Dass aus dem Kunstwerk ein erzkapitalistisches Handelsgut geworden ist, heißt nicht, dass sein künstlerischer Wert keine Rolle spielen würde. Im Gegenteil: Das Immaterielle, die Aura und der anhaltende Ruhm Leonardos begründen ja gerade den stolzen Preis. Eine einfache Holzplatte aus der Renaissance, bemalt mit bunten, Farben wäre uninteressant. Niemand würde aufwendige, schwer bewachte Läger dafür bauen. Kein Oligarch, kein Scheich würde sich je dafür interessieren. Als Handelsgut ist das Kunstwerk freilich säkularisiert: Man darf vermuten, dass dem Kronprinzen von Abu Dhabi der religiöse Sinn der Christus-Ikone gleichgültig ist. Er hätte auch einen indischen Buddha erstanden, würden der Markt und er danach gerade gieren.Inzwischen sollte meine These plausibel geworden sein, dass der Kunstmarkt die Urform der der Marktwirtschaft darstellt – ein »unregulierter Dschungel« (Martin Kemp) eben. Käufer und Verkäufer auf einem Marktplatz sind niemandem Rechenschaft darüber schuldig, warum sie kaufen oder verkaufen. Sie müssen dies auch niemandem »ad hoc« annoncieren. Zölle und Steuern sind Übergriffe des Staates auf die Werte der Eigentümer, die sich diesen Übergriffen zu entziehen suchen. Preise sind das, was jemand zu zahlen bereit ist, unabhängig davon, wie hoch oder niedrig irgendwelche Experten den Wert bemessen. Renditen ergeben sich aus der Differenz zwischen Ankauf und Verkauf: Wenn es jemandem glückt, mit einem Produkt an einem Tag 50 Millionen Dollar zu machen, hat er eben Glück gehabt. Märkte per se sind weder moralisch noch unmoralisch. Gerade deswegen muss man sie zuweilen regulieren.
Am Ende verflüchtigt sich übrigens auch noch der Gegensatz zwischen die Kunst und Wirtschaft. Fiktiv und real sind nämlich keine hilfreichen Unterscheidungskategorien. Der Münsteraner Ökonom Holger Bonus hat 1990 ein schönes Buch über »das Unwirkliche in der Ökonomie« geschrieben. »Was für einen Rembrandt oder einen Picasso gilt, trifft auch für erstklassige Immobilien und sogar für so handfeste Träger von Wert wie Geld, Gold und Wertpapiere zu. Der verkörperte Wert kann sich jäh daraus verflüchtigen, ohne dass sich physisch irgendetwas verändert hätte.« Kunst wäre dann nicht der Spezialfall des Marktes, sondern ihr Modell.
Rainer Hank
02. Oktober 2019
Volksverhexer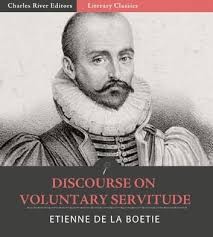
Warum sich Populisten und Demokraten vertragen
Wohin treibt die Demokratie? Ganz offenkundig bietet sie keinen Schutz gegen den Populismus. Im Gegenteil: Die Stimmen der Mehrheit werden zum willfährigen Instrument der Manipulation im Interesse populistischer Führergestalten. Während die Eliten seit Jahren analysieren, warum der Populismus schädlich ist, zeigt das Volk sich von den Argumenten der Eliten-Intelligenz unbeeindruckt und bleibt loyal zu den populistischen Führern, die durch sie an die Macht gekommen sind.
Warum begeben sich Wähler freiwillig in die Knechtschaft von Volks-Tribunen? Warum imprägnieren sie sich gegen die Argumente der Eliten? Ja, mehr noch, warum richtet sich ihre Wut eher gegen die Eliten, von denen sie sich unterdrück fühlen, als gegen ihre Herrscher, die in Wirklichkeit nicht ihr Bestes wollen? Per Zufall fiel mir kürzlich ein kleines Büchlein in die Hand, das den kühnen Titel trägt »Abhandlung über die freiwillige Knechtschaft«. Veröffentlicht wurde es im Jahr 1574 von einem Mann aus dem Südwesten Frankreichs namens Etienne de la Boétie. Dazu später mehr.
Monopolisten der Macht – demokratisch gewählt
Zunächst zur aktuellen polit-ökonomischen Situation: Seit geraumem lässt sich in vielen Ländern eine Monopolisierung der Macht beobachten durch einen Führer an der Spitze und unter Rückgriff auf frühere autoritäre Traditionen der Staatsführung. In Wladimir Putin lebt die zaristische Tradition, in Recep Erdogan das Sultanat wieder auf. Donald Trump will America First, Boris Johnson will das britische Imperium zurück haben. Es handelt sich allemal um Männer an der Staatsspitze (nehmen wir Victor Orban oder Jaroslav Kaczynski hinzu), die sich offen zur Lust an der Macht bekennen und darin ganz offensichtlich nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Untergebenen gefallen. Erdogan, Orban & Co. verwandeln offene Demokratien in protektionistische Autokratien. Sie beschneiden Freiheiten und verhindern Wettbewerb. Oder anders gesagt: Trump & Co. wollen ihr Land wie eine Firma führen: autoritär als CEO.
Alle diese Männer sind demokratisch an die Macht gekommen. Ohne die Loyalität ihrer Völker wären sie nichts. Mehr noch: Diese populistischen Führer nutzen die ihnen demokratisch verliehene Macht zum Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit. Sie verändern die »Balance of Power« zu ihren Gunsten: Judikative, Medien, Wissenschaft oder Wirtschaft müssen das Machtmonopol des Anführers akzeptieren oder es geht ihnen an den Kragen. All das vollzieht sich schleichend, innerhalb der bestehenden Systeme, ohne dass ein Putsch oder gar eine Revolution nötig wären. Systemveränderung verläuft systemimmanent.
Anschaulich machen lässt sich der Prozess der Monopolisierung der Macht besonders gut an Victor Orban in Ungarn. Das geltende Wahlsystem dort hat es möglich gemacht, dass seine Fidesz-Partei mit nur 53 Prozent der Wählerstimmen zwei Drittel der Sitze im Parlament innehat. Mit dieser starken Verankerung der Macht in der Legislative gelang es Orban, trickreich, die Rechtsinstitutionen des Landes zu verändern: Dazu mussten keine unliebsamen Richter entmachtet oder Gerichtshöfe neu geschaffen werden. Es genügte schon, die Zahl der Richter am Verfassungsgericht von elf auf fünfzehn zu erhöhen und die vier neuen Stellen mit Fidesz-Leuten zu besetzten. Auf ähnliche Weise werden Medien gleichgeschaltet, Universitäten und Wissenschaftsinstitutionen aus dem Land vertrieben. Aber das Volk bleibt bei der Stange.
Ungarn ist nur ein Beispiel für den zentralisierenden Mechanismus populistischer Machtentfaltung. Es braucht dafür kein Einparteiensystem, wie die Vereinigten Staaten zeigen. Es funktioniert in alten Demokratien (Amerika) genauso wie in jungen Demokratien (Türkei, Russland). Allerdings entfalten die rechtsstaatlichen Institutionen in den alten Demokratien eine größere Resilienz: Den High Court anzutasten wagt der Brite Boris Johnson – bislang – nicht. Schmollend unterwirft er sich dem Spruch. Der Versuch, mit der öffentlichen Meinung gegen das Parlament zu regieren, ist vorerst gescheitert.
Warum begibt man sich freiwillig in Knechtschaft?
Das alles führt direkt zu Etienne de la Boétie, den Autor des späten 16. Jahrhunderts. Wir kennen ihn vor allem durch den französischen Moralisten Michel de Montaigne, der von Boéties Abhandlung über die »freiwillige Knechtschaft« so begeistert war, dass er beschloss, den Verfasser kennen lernen zu wollen. Daraus ergab sich eine innige Freundschaft bis zum frühen Tod Boéties. Lange wurde spekuliert, ob die »Abhandlung« in Wirklichkeit womöglich von Montaigne selbst stammt. Inzwischen wird diese Hypothese seriös nicht mehr vertreten. De la Boétie. der kühne Autor, schrieb den Essay als Sechzehnjähriger.
»Das Volk selbst schlägt sich in Fesseln, schneidet sich die Kehle ab, gibt die Freiheit für das Joch dahin«, heißt es bei de la Boétie. Wie verhext muss das Volk sein, das es den Tyrannen sogar noch bewundert, wenn er nicht mehr lebt: Neros Tod wurde vom Volk betrauert. Als Stalin starb, flossen Tränen. Das alles ist unfassbar, weil die Freiheit doch eigentlich das natürlichste und höchste Gut sein müsste, etwas, was niemand ohne Zwang gegen eine Selbstversklavung eintauschen würde, findet de la Boétie. Woher kommt das »Gift der Knechtschaft«. Demokratische Herrscher, schreibt de la Boétie, seien nicht besser als gewaltsame Usurpatoren oder erbrechtlich abgesicherte Monarchen. Alle erliegen sie dem »Reiz der Größe«, wollen die Macht, einmal errungen, nicht mehr abgeben. Auch der demokratische Herrscher trachtet danach, die Macht, die ihm vom Volk verliehen wurde, anschließende gegen dieses zu wenden.
Doch die »Lockpfeife der Knechtschaft« – Boétie hat lauter solch schöne Formulierungen – ist eben nicht die Gewalt, sondern die Verführung: Es ist sogar eine besonders geschickte Verführung, mit der es dem demokratischen Herrscher gelingt, sich die Abhängigkeit, ja Liebe seiner Untertanen zu sichern, wofür sie sogar bereit sind, ihre Freiheit zu opfern. Mittel der Verführung sind »Spiele und Possen«, vor allem aber vom Herrscher verteilte materielle Wohltaten: »und so betrogen sie den Pöbel, dessen Herr immer der Bauch ist«. In heutiger Übersetzung könnte man vielleicht sagen: Es ist der Wohlfahrtsstaat, der den Populisten entgegenkommt, wenn sie sich ihre Macht sichern wollen. Sie teilen »Korn, Wein und Geld« aus, schreibt Boétie – und erkaufen sich damit die Wiederwahl.
In all dem zeigt sich die erstaunliche Modernität des französischen Autors. Die Konsequenz ist beunruhigend: Der Populismus ist kein Betriebsunfall der Demokratie, sondern mit ihrem Wesen bestens vereinbar. Demokratischer Populismus ist der größte Feind der Rechtsstaatlichkeit, gerade weil er sich für den Umsturz keiner gewaltsamen Putschisten bedienen muss.Demokratischen Populismus wird man nur ganz schwer wieder los. Etienne de la Boétie indes ist am Ende kein Fatalist. Er glaubt nicht, dass die Menschen dauerhaft dazu bereit sind, sich ihre Freiheitsrechte gegen »Brot und Spiele« abkaufen zu lassen. Sein Freiheits-Imperativ lautet: Hört auf, den Populisten zu gehorchen. Kassiert eure freiwillig gegebene Einwilligung, Sklave der Volkstribunen zu sein. »Stillschweigende Verweigerung«, war die Wendung de la Boéties. Im 20. Jahrhundert hätte man das »zivilen Ungehorsam« genannt.
Rainer Hank
27. September 2019
Was ist eigentlich sozial?
Gefrorene Mieten, eigennützige Politiker und die Tücken der Sprache
Es ist Winter in Berlin. Denn dort – man verzeihe den Kalauer – werden jetzt die Mieten eingefroren. Warum? Weil die rot-rot-grüne Regierung der Hauptstadt der Meinung ist, der Mietzins für Wohnungen sei in den vergangenen Jahren auf eine für die Menschen unzumutbare Höhe angestiegen. Das ist im Übrigen nicht nur die Ansicht des Berliner Senats, sondern auch der Bundesregierung. Die kommt nur nicht gleich mit dem Gefriergerät daher. Stattdessen will sie den Mietspiegel in seiner Struktur neu berechnen. Für die »ortsübliche Vergleichsmiete«, an der sich Vermieter orientieren müssen, sollen fortan nicht mehr nur die vergangenen vier, sondern sechs Jahre herangezogen werden. Weil Wohnen aber vor sechs Jahren billiger waren als vor vier Jahren, ist der Effekt der Maßnahme klar: Mietsteigerungen sollen erschwert oder verhindert werden. Das alles gilt als soziale Maßnahme und wird von vielen Menschen auch so verstanden.
Man muss sich, nur so zum Vergleich, einmal vorstellen, die deutsche Industrie würde unter Anführung sozialer Gründe bei der Bundesregierung durchsetzen, dass die Löhne für ihre Arbeiter künftig nur im Maße der »ortsüblichen Vergleichslöhne« steigen dürfen und als Referenzrahmen dafür jenen Lohn zur Grundlage nehmen, der vor zehn Jahren gezahlt wurde. Das wäre dann eine Art Lohndeckel, der nötig wäre, um für einen Zeitraum von fünf Jahren eine Konjunkturkrise zu meistern. Man sieht sofort: Noch nicht einmal die ausgebufftesten Kapitalisten würden einen solchen Vorschlag wagen, denn es würde sofort ein Aufschrei der Empörung durch das Land gehen. Mieter dürfen soziale Gründe geltend machen, um staatliche Preisregulierungen durchzusetzen. Fabrikanten dürfen das natürlich nicht. Das könnte auch daran liegen, dass Mieter für Politiker wichtiger sind als Fabrikanten, einfach weil es mehr davon gibt.
Mieten müssen abgesenkt werden
Die Grundsatzfrage heißt: Was ist sozial? Oder besser: Wer hat die Macht, soziale Begründungen zur Durchsetzung von Preisvorteilen geltend zu machen? Dazu müssen wir uns das Berliner Modell einmal genauer anschauen. Ich zitiere aus dem Referentenentwurf »Mietendeckel« vom 2. September (nachzulesen auf der Internetseite des Berliner Senats): »Mietenstopp heißt, dass keine höhere als die am 18. Juni 2019 geltende Nettokaltmiete gezahlt werden muss. Auch für Staffel- und Indexmieten gilt, dass die Miete, die am 18.6.2019 gezahlt wurde, eingefroren wird. Wenn eine Wohnung wiedervermietet wird, darf nur die Nettokaltmiete des Vormieters genommen werden.« Die Mietobergrenze schwankt zwischen 3,92 Euro und 9,80 je Quadratmeter, abhängig vom Alter und der Ausstattung (mit oder ohne Sammelheizung und Bad) der Wohnung. Die Lage spielt keine Rolle: Eine Wohnung am Kudamm oder am Prenzlauer Berg wird nicht anders behandelt als eine Wohnung in Marzahn.
Es kommt noch radikaler: »Eine Miete kann abgesenkt werden, wenn sie die Mietobergrenze überschreitet, wenn der betroffene Haushalt mehr als 30 Prozent seines Gesamteinkommens für die Miete aufbringen muss und wenn kein Härtefall für Vermieterinnen vorliegt.« Machen wir ein Beispiel: Zahlt ein Single mit einem Einkommen von 2600 Euro für eine Altbau-Wohnung von 65 Quadratmetern eine monatliche Miete von 780 Euro, kann er eine Absenkung der Miete um 360 Euro auf 419 Euro durchsetzen. Mithin würde er mithilfe des Berliner Senats seine monatliche Mietbelastung annährend halbieren. Der Regierende Bürgermeister von Berlin sagt zwar, dass ihm so eine Absenkung der Miete nicht gefalle. Aber auf der offiziellen Seite seines Senats findet sich der Passus bis heute.
Dass durch das Einfrieren von Mieten keine neuen Wohnungen entstehen, hat sich inzwischen herumgesprochen. Mehr noch: Je rigider staatliche Eingriffe in den Wohnungsmarkt ausfallen, um so knapper wird das Angebot an Wohnungen. Das alles ist schwer zu widerlegen und zeigt den ökonomischen Unsinn eingefrorener Mieten. Indes lässt sich natürlich gleichwohl sagen, dass ein Mietendeckel »sozial« ist, auch wenn er die Wohnungsnot allgemein nicht lindert. Denn immerhin bringt er allen Mietern, die jetzt in einer Mietwohnung leben, die amtliche Gewissheit, dass ihre Mieten fünf Jahre lang nicht steigen werden. »Sozial«, so ließe sich definieren, ist, wenn es weniger teuer wird als von den Betroffenen befürchtet. Begründungen dafür (»Wohnen ist ein Menschenrecht« etcetera) lassen sich beliebig finden.
Und wer denkt an die Vermieter?
Es fällt freilich auf, dass ein Anrecht auf soziale Hilfe vom Staat offenbar nur eine Seite genießt: die Mieter. Was aber ist mit den Vermietern, die wir uns einen Moment lang und ziemlich realistisch nicht nur als steinreiche Miet-Haie oder renditegierige Immobilienunternehmen vorstellen wollen, sondern als ganz normale Leute, die in ihrem persönlichen Portfolio zur Alterssicherung in Zeiten von Null- oder Negativzinsen eben auch eine oder gar drei Wohnungen halten. Sie erwarten in aller Vorsicht eine niedrige reale Verzinsung ihrer Immobilien, was bedeutet, dass die Mieten moderat (mindestens im Tempo der Inflation steigen) müssen. Natürlich rechnen sie mit den Volatilitäten des Marktes. Womit sie nicht rechnen konnten – und auch nicht mussten – ist, dass ihnen ihre bescheidene Renditeerwartung durch staatlichen Eingriff nun fünf Jahre lang verwehrt werden soll. Ihnen wird durch den Mietdeckel Geld genommen und zwar selbst dann, wenn sie nicht gezwungen werden, ihre Mieten auch noch abzusenken. Das kann man als einen staatlich verordneten finanziellen Verlust, eine Art von Enteignung, bezeichnen, den sie hinnehmen müssen, sollte der Plan Berlins Gesetz werden und verfassungsrechtlich Bestand haben. Zwar spricht der Mietdeckel von »Härtefällen«, die aber nur für die Mietsenkung geltend gemacht werden können und die als »dauerhafte Verluste« und »Substanzgefährdung der Mietsache« definiert werden. Daraus lässt sich schließen, dass die zuständigen Härtefall-Prüfstellen das »ganz normale« Abschmelzen der erwarteten Alterssicherung, den das Einfrieren der Mieten zur Folge hat, nicht als Härtefall durchgehen lassen wird.
Merke: Mieten einfrieren lässt Renditen schmelzen, was weder physikalisch noch logisch gut gehen kann. Finanzielle Wohltaten für Mieter – fünf Jahre lang keine Mieterhöhung – gelten als sozial. Finanzielle Zumutungen für Vermieter (sozioökonomisch handelt es sich um dieselbe Gruppe) – fünf Jahre lang Verluste bei ihrer privaten Altersrente – gelten nicht als unsozial. Da stimmt etwas nicht.
Fazit: Sozial ist ein Wort, das nur mit äußerster Vorsicht verwendet werden sollte. Denn man kann es nutzen, wie man es gerade braucht. Erst recht, wenn Politiker es verwenden, ist der Sache nicht zu trauen: Der Job von Politikern ist es nicht, Gutes zu tun, sondern Wähler zu gewinnen. In diesem Interesse setzten sie den Begriff »sozial« ein. Der Philosoph und Ökonom Friedrich August von Hayek nannte »sozial« ein Wieselwort. Dem Wiesel wird nachgesagt, dass er aus einem Ei allen Inhalt heraussaugt, ohne dass man dies nachher der leeren Schale anmerkt. Wiesel-Wörter sind Wörter ohne Inhalt. Deshalb eben eignen sie sich besonders gut zum polit-strategischen Gebrauch.
Rainer Hank
17. September 2019
Bankrott des Christentums
Ökonomische Gedanken zum Massenexodus der Gläubigen
Die Katholische und Evangelische Kirche in Deutschland verlieren massiv Mitglieder. Allein den Katholiken liefen im vergangenen Jahr über 200 000 Gläubige davon. Das ist die zweithöchste Austrittszahl seit Ende des II. Weltkriegs. Weil zudem mehr Katholiken sterben als Neuchristen getauft werden, beziffert sich der Verlust auf insgesamt 310 000 Ex-Gläubige. In der evangelischen Kirche sieht es nicht besser aus: Zwar gibt es weniger Austritte, dafür aber noch weniger Neueintritte als bei den Katholiken: Das führt zu einem Schwund von fast 400 000 Protestanten in nur einem Jahr 2018.
Wenn es so weitergeht, werden die Mitgliederzahlen beider Kirchen bis zum Jahr 2060 noch einmal um die Hälfte zurückgehen, hat im Frühjahr der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen hochgerechnet. Dafür ist längst nicht nur der demographische Wandel verantwortlich – nach dem Motto: »Kannste nichts machen, wenn die Christgläubigen keine Kinder mehr kriegen.« Doch Zweidrittel des Schwunds haben nichts mit der Demographie zu tun. Da könnte man schon etwas machen, wenn man könnte.
Alles begann mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil
Es liegt nahe, die Dramatik der Austritte auf den Missbrauchsskandal zurückzuführen und, womöglich noch gravierender, das Versagen der Kirche bei der Aufarbeitung dieses Skandals. Doch die Wahrheit ist viel schlimmer: Die Abwendung vom Christentum dauert schon viel länger. Nach dem Krieg war die konfessionelle Welt in Deutschland noch in Ordnung: Man war entweder evangelisch (50 Prozent) oder katholisch (45 Prozent), der ungläubige Rest war vernachlässigbar. In konfessionsverschiedenen Orten wussten die Leute voneinander, wer welchem Glauben anhing: Katholiken kauften ihre Wurst beim katholischen Metzger, Protestanten beim evangelischen Fleischer. Auch 1970 stimmte diese konfessionelle Ordnung noch: Katholisch waren 44 Prozent, evangelisch 49 Prozent der Deutschen. Erst danach ging es los: Heute gehört nur noch jeder zweite Deutsche einer der beiden Konfessionen an. Während 1950 jeder zweite Katholik regelmäßig sonntags zur Messe geht, ist es heute nicht einmal mehr jeder Zehnte.
Was ist passiert? Kirchenmänner und Theologen schwurbeln sich durch (Kardinal Reinhard Marx), verweisen auf die schwindende Gottesbindung und fordern den verbliebenen frommen Rest zum Gebet auf (Kardinal Walter Kasper). Das kann man versuchen. Ökonomen und Soziologen werden ein bisschen konkreter. Von »Massenexodus« spricht der in London lehrende Religionssoziologe Stephen Bullivant in seinem gerade bei Oxford University Press erschienenen Buch über Sezession und Glaubensabfall in der Katholischen Kirche. Der Clou: Ausgerechnet das II. Vatikanische Konzil (1962 bis 1965), welches Aufbruch und neue Kraft für die Kirche bringen sollte, war der Anfang vom Ende. Die Sache hatte auch damals schon viel mit Sex zu tun, kirchlich »Sexualmoral« genannt: In seiner Enzyklika »Humanae vitae« von 1969 verbot Papst Paul VI. den Katholiken jegliche Empfängnisverhütung außer der natürlichen. Doch die Katholikinnen nahmen lieber die damals neue Antibabypille und kehrten ihrer Kirche den Rücken – ein Akt massiver Gehorsamsverweigerung, wie es ihn früher nie gegeben hätte. Parallel dazu verwilderte der Kult: die Protestanten verliebten sich in den linken Moralismus, die Katholiken nahmen die Klampfe zur Hand und verkitschten ihre schöne Liturgie. Soziologe Bullivant spricht von »happy-clappy liturgy«. Das sind immer noch nicht alle Gründe: zur abnehmenden Glaubwürdigkeit des kirchlichen Personals, dem Kopfschütteln über die Haltung der Amtskirche zu Scheidung, Homosexualität oder vorehelichem Sex, kommen Zweifel der Christen daran, ob es ein Leben nach dem Tod (einerlei ob im Himmel oder in der Hölle) gibt und ob Gott wirklich existiert.
Schadet die Entchristlichung dem Wohlstand?
Religionssoziologen machen einen Unterschied zwischen »Glauben« und »Kirchenmitgliedschaft« (»believing« versus »belonging«). Man kann an Gott glauben, ohne je in die Kirche zu gehen. Man kann aber auch in den Gottesdienst gehen, etwa weil dort Johann Sebastian Bachs Kantaten zu hören sind, und an der Existenz Gottes zweifeln. Beides zählt als »religiöses« Verhalten. Beides hat dramatisch abgenommen – und zwar in allen reichen Ländern der Welt. In den Vereinigten Staaten, wo es viel mehr Kirchen-Wettbewerb gibt, gehen von hundert Getauften heute noch 15 Prozent zur Sonntagsmesse; 35 Prozent von ihnen haben den Glauben an die christliche Erlösungslehre verloren. In Großbritannien sieht es ähnlich aus. Zuwächse verzeichnen einzig die »Pfingstler«, jene kapitalismusfreundlichen sogenannten »Health- and Wealth-Christen«, die nicht nur in Amerika, sondern beispielsweise auch im kommunistischen China viel Zustrom verzeichnen.
Angesichts dieses beispiellosen Massen-Exodus seit fünfzig Jahren bekommt die alte These Max Webers über die Entzauberung der Welt wieder neue Freunde. Robert Barro, ein Harvard-Ökonom, der mit Arbeiten über rationale Erwartungen und die Rolle der Geldpolitik berühmt geworden ist und als Kandidat für den Ökonomie-Nobelpreis gehandelt wird, hat zusammen mit seiner Frau Rachel McCleary, einer Religionswissenschaftlerin, immer schon viel über die Ökonomie des Religiösen geforscht. Jetzt haben die beiden in einem spannend zu lesenden Buch die Summe ihres Nachdenkens vorgelegt (»The Wealth of Religions«). Zwei Fragen stehen im Zentrum: Trägt religiöser Glaube zum Wohlstand der Nationen bei? Und: Führt wachsender Wohlstand zu einem Schwund religiöser Praxis und religiösen Glaubens? Letzteres ist die klassische, ebenfalls von Max Weber stammende Säkularisierungsthese, welche von Barro-McCleary rehabilitiert wird. Das bedeutet nicht, dass Religion am Ende ganz aus der Welt verschwände und durch atheistische Rationalität eScrsetzt würde. Doch seit der religionskritischen Aufklärung haben die Menschen mehr Optionen, wie und woher sie ihrem Leben Sinn geben können. Der Wettbewerb wurde schärfer. Das dezimiert die Gruppe der Christen sozusagen von alleine, wenn neue Akteure Marktanteile ergattern. Wenn dann – auf der Angebotsseite würden Ökonomen sagen – eine Verschlechterung des religiösen Produkts und eine massive Vertrauenskrise der Firma hinzu kommt, dann nimmt die Nachfrage nach Religion schlicht aus ökonomischen Gründen ab.
Robert Barro, ein säkularer Jude, findet das übrigens gar nicht gut und zwar abermals aus ökonomischen Gründen. Denn es lässt sich empirisch zeigen, dass der christliche Glaube sehr hilfreich ist für Wachstum und Wohlstand eines Landes. Dabei spielt »Believing«, das aus dem Glauben heraus motivierte leistungsfreundliche Arbeitsethos, eine deutlich wichtigere Rolle als »Belonging«, die soziales Kapital generierende kirchliche Gemeinde. Überspitzt gesagt heißt das: Ein dramatischer Rückgang des christlichen Gottes- und Erlösungsglaubens ist schlecht für das Wirtschaftswachstum. Ob das die Kirchen motivieren wird, die Qualität ihres religiösen Angebotes zu bessern, wage ich zu bezweifeln. Denn sie müssten dafür ihren Antikapitalismus über Bord werfe. Doch den hat Papst Franziskus anlässlich einer Reise nach Madagaskar gerade vehement erneuert.
Rainer Hank
