Hanks Welt
‹ alle Artikel anzeigen23. März 2020
Was heißt hier Solidarität?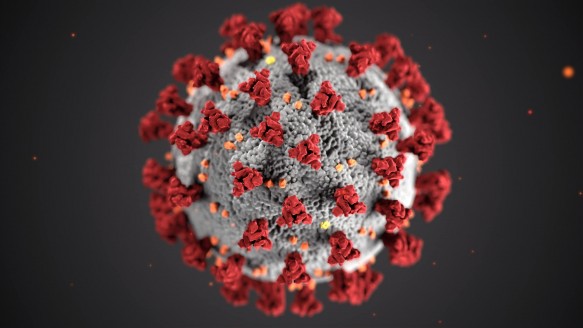
Über den Altruismus in Zeiten von Corona
Es war ein heißer Julitag des Jahres 1974 in Griechenland, als plötzlich und unerwartet die Militärdiktatur gestürzt wurde. Der frühere Ministerpräsident Konstantinos Karamanlis sollte aus dem Exil zurückkommen und wurde auf dem Syntagma-Platz von Athen erwartet. Vor dem Parlament kam eine riesige Menschenmenge zusammen. In den Stunden zuvor hatte die Militärjunta Dutzende Lastwagen mit Soldaten und Lautsprechern durch die Straßen fahren lassen. »Bürger von Athen!«, brüllten die Bewaffneten: »Bleibt zu Hause!« Doch die Demonstranten ließen sich nicht einschüchtern. Die Demokratie siegte, die Diktatur hatte verloren.
Nicholas Christakis, der als kleiner Junge mit seiner Mutter auf dem Syntagma-Platz demonstriert hat, ist heute ein Professor für Evolutionsbiologie an der Universität Yale. Kürzlich ist sein neues Buch »Blueprint« erschienen, das davon handelt, was uns als Menschen eint. Es beginnt mit der Erinnerung an die Demo in Athen. Was Christakis sagen will: Menschen sind schon von ihrer genetischen Disposition her soziale Wesen. Sie existieren in der Gruppe. Wenn sie friedlich und solidarisch auftreten, vermögen sie es sogar, die Bösen vom Thron zu stürzen. Es hat gute Gründe, dass in vielen Verfassungen freiheitlich-demokratischer Gesellschaften die Versammlungsfreiheit ein Grundrecht ist.
Es herrscht der Ausnahmezustand
Man muss die positive Macht von Demonstrationen nicht romantisieren – Massen können bekanntlich auch viel Schlimmes anrichten. Doch die kleine Geschichte aus Athen verdeutlicht: Solidarität braucht den öffentlichen Raum und die Erfahrung menschlicher Nähe. Ihr pathetisches Emblem hierzulande ist die Lichterkette vieler Menschen mit Kerzen in den Händen. Im stillen Kämmerlein kann man nicht gut solidarisch sein. Das, so scheint es mir, ist ein Grundproblem dieser Corona-Wochen, wo wir aus guten Gründen aufgerufen werden, solidarisch zu sein, man uns aber nicht auf die Straßen und Plätze lässt, erst recht nicht in die Hospize und Hospitäler, um denen, die unsere Solidarität besonders nötig haben, unser Mitgefühl durch unsere Nähe zu zeigen. Der Aufruf, solidarisch sein, bleibt abstrakt in Zeiten des Ausnahmezustands, in denen das öffentliche Leben lahmgelegt und das Recht der freien Versammlung faktisch außer Kraft gesetzt ist. Fast scheint es, als ob sich diese Paradoxie in den Corona-Partys in den öffentlichen Parks zeigt, wo Menschen, die doch nur einander nah sein wollen, das Schlimmste anrichten: die Ausbreitung des Virus zu beschleunigen, anstatt den Prozess zu drosseln.
Gewiss, man kann Leute, die kiloweise Mehl oder Konserven hamstern, unsolidarisch nennen, weil sie ihren Mitmenschen Lebensmittel entziehen. Aber vielleicht reicht es auch, solches Verhalten einfach nur als ungehörig oder meinetwegen egoistisch zu schelten. Kurzum: Ich bin skeptisch, ob uns die Beschwörung einer Ethik der Solidarität in diesen schweren Zeiten weiterhilft. Das merkt man nicht zuletzt daran, dass auch Politiker ihren Aufruf zur Solidarität stets mit einer Drohung verbinden: Wenn ihr euch nicht freiwillig sozial isoliert, dann verordnen wir eine Ausgangssperre. Wie man in Bayern seit gestern sieht, ist das ernst gemeint. Solidarität – wahrlich eine »große Idee« (Heinz Bude) – lebt davon, dass sie gerade nicht angeordnet werden kann. Staatlich befohlen ist sie noch nicht einmal halb so viel wert.
Solidarität und soziale Distanz: ein Widerspruch
Alena Buyx, eine an der TU München lehrende Medizinethikerin, die auch Mitglied des deutschen Ethikrates ist, kommt in ihrem 2016 zusammen mit einer Ko-Autorin verfassten Buch über das Solidaritätsprinzip in der Medizin (Campus Verlag) zu dem Schluss, dass die bei Pandemien nötigen Maßnahmen allenfalls teilweise als »solidarische Praktiken« eingeordnet werden können. Es gehe stattdessen schlicht um die Pflicht staatlicher Institutionen, ihre Bürger zu schützen. Das hat wenig mit Solidarität zu tun und schon gar nicht mit Kampf oder gar Krieg gegen ein Virus, das nicht zu besiegen ist, sondern – ganz im Gegenteil – integriert werden muss in das menschliche Immunsystem. Natürlich brauchen solche staatlichen Maßnahmen die Akzeptanz in der Bevölkerung. Dabei geht es dann um Einsicht der Vernunft in das Notwendige. Mag sein, dass die Opfer sozialer Distanzierung einigen leichter fallen, wenn sie sie Solidarität nennen, um ihnen eine altruistische Funktion zu geben.
Dass Solidarität nicht zielführend ist, zeigt sich besonders bedrückend, wenn es um die Priorisierung knapper medizinischer Ressourcen geht. Gewiss hätten wir gerne, dass allen Kranken sofort jedwede medizinische Versorgung zuteil wird. Aber das geht schon unter normalen Bedingungen nicht. Priorisierung, im schlimmsten Fall Rationierung der medizinischen Leistungen könnten nötig werden; wir beobachten diese Katastrophe gerade mit großem Mitleid in Italien. Auch hierzulande gibt es heute schon Priorisierung, wenn die Krankenhäuser angewiesen sind, »normale« Operationen auf die Zeit nach der Pandemie zu verschieben. »Harte Rationierung« auf alle Fälle zu verhindern, also die Zuteilung intensivmedizinischer Leistungen unter Bedingungen absoluter Knappheit, das steckt ja gerade hinter der Pflicht, soziale Kontakte zu vermeiden. Zugleich wird das medizinische Angebot laufend ausgeweitet (auch mit Hilfe der Bundeswehr) und auf die Erfordernisse der Pandemie fokussiert.
Doch auch wenn diese Anstrengungen hierzulande erfolgreich sind, führt kein Weg an der ökonomischen Einsicht vorbei, dass es bei medizinischen Ressourcen immer um Fragen der Verteilung und Prioritätensetzung gehe, sagte die Ethikprofessorin Alena Buyx dieser Tage in einem Interview. Das von Empathie gespeiste Solidaritätsprinzip würde verlangen, demjenigen zuerst zu helfen, der die Hilfe am nötigsten braucht. Doch viele Pandemiepläne und Leitfäden für die ärztliche Versorgung im Katastrophenfall haben vernünftige Gründe dafür, nach dem »größtmöglichen Nutzen für viele« die Hilfe zu priorisieren. Im Klartext heißt das: Schwerstkranke mit den geringsten Überlebenschancen werden erst dann behandelt, wenn ausreichend Ärzte und Logistik für alle zur Verfügung stehen. Unserer solidarischen Intuition läuft das zutiefst zuwider: Menschenleben solle man nicht gegeneinander aufrechnen, heißt es. Aber der Realismus der Knappheit von Ressourcen und Zeit verlangt, die Augen nicht zu verschließen, sondern Kriterien einer Ethik der Priorisierung zu entwickeln. Dass Geld, also das Zuteilungsprinzip knapper Ressourcen auf Märkten, keine Rolle spielen darf, versteht sich von selbst. Auch abstrakte Altersregeln, wonach etwa Patienten über 60 Jahren nachrangig behandelt werden, hält Alena Buyx für problematisch. Ihr Kriterium lautet: Es kommt auf den klinischen Zustand der Kranken an und deren »ability to benefit«, also der Chance, von der Behandlung zu profitieren. Sie würden dann – geheilt – das Intensivbett rasch wieder für andere Kranke frei machen.
Das alles sind ethisch äußerst sensible Überlegungen für Entscheidungen, die ein Höchstmaß an Verantwortungsgefühl verlangen, deren Kriterien aber nicht selten kontraintuitiv sind. Ich fürchte, dass gerade deshalb der Appell an die intuitive Solidarität nicht nur nicht weiter, sondern auch in die Irre führt.Rainer Hank
