Hanks Welt
‹ alle Artikel anzeigen21. Juli 2020
Schuster bleib bei Deinen Leisten!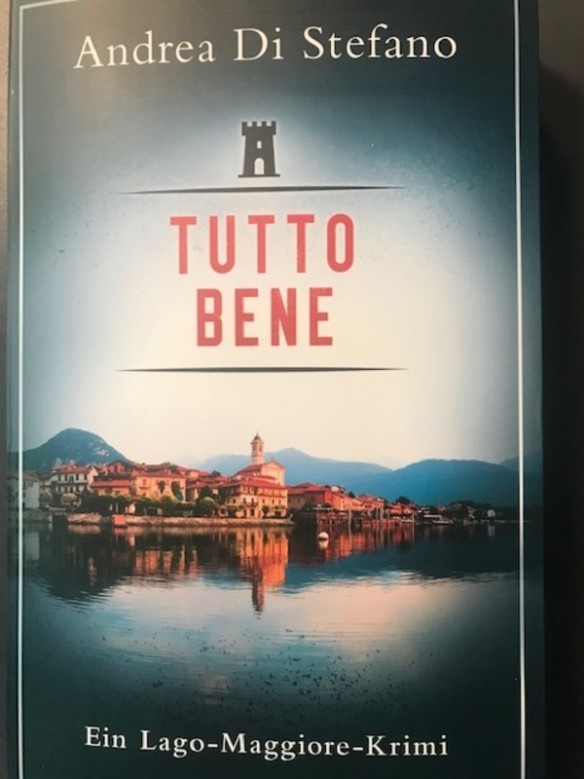
Firmen müssen Gewinne machen, was denn sonst
Ich wohne in einem Turm aus dem Mittelalter. Mit diesem Satz beginnt der spannende Lago-Maggiore-Krimi »Tutto Bene« von Andrea Di Stefano, den ich vergangene Woche in meine Ferien am Bodensee mitgenommen habe. Pinienduft, Espresso und ein paar zünftige Leichen: Was braucht der Urlauber zwischen Konstanz und Überlingen mehr!
Der Krimi ist erschienen im Scherz-Verlag und der wiederum gehört zum S. Fischer-Verlag, einem Haus mit großer Tradition, denkt man an Thomas Mann oder Hugo von Hofmannsthal. Auf der ersten Seite des Buches, noch bevor der Krimi losgeht, teilt der Verlag mir mit, man habe sich aus Verantwortung für die Umwelt zu einer »nachhaltigen Buchproduktion« verpflichtet: »Der bewusste Umgang mit unseren Ressourcen, der Schutz unseres Klimas und der Natur gehören zu unseren obersten Unternehmenszielen«, heißt es da. Bislang habe ich angenommen, das oberste Ziel eines Verlages sei es, gute Bücher herzustellen. Muss man sich um S. Fischer Sorgen machen? Glauben die Verlagsleute nicht mehr an das Geschäftsmodell Buch und suchen deshalb nach neuen »obersten« Unternehmenszielen?Der Fischer-Scherz-Verlag ist kein Einzelfall, eher ein Nachzügler. Es gibt eine Mode, die seit ein paar Jahren um sich greift und immer mehr Nachahmer findet: Ein Unternehmen braucht einen »Purpose«, also einen Zweck, der seine Existenz rechtfertigt. Natürlich musste eine Firma immer schon einen Zweck haben. Dem genialen Tüftler Robert Bosch reichte es im Jahr 1901 noch, eine Zündkerze – den »Bosch-Zünder« – als Patent anzumelden, um sein Unternehmensziel zu erfüllen. Das würde heute nicht mehr durchgehen, während es bei Bosch damals zur Initialzündung eines nachhaltigen Weltkonzerns gereicht hat.
Sinnmaximierung statt Gewinnmaximierung
Heute ist der »Purpose« etwas, das gerade nichts mit den Produkten zu tun hat, die die Firma herstellt. Es geht um einen »höheren Zweck«, wie Professor Bernd Thomsen schreibt, einer der vielen Managementberater, die im Purpose-Business Geld verdienen. »Sinnmaximierung« statt »Gewinnmaximierung«, so laute die Devise. Firmen dürften nicht mehr auf ihren eigenen Vorteil bedacht sein, lese ich bei Professor Thomsen: »Das Anforderungsset an Unternehmen reicht künftig über einwandfreies kaufmännisches Verhalten weit hinaus.« Denn laut Harvard Business Review, eine der ersten Adressen der angesagten Management-Empfehlungen, ist es die wichtigste Aufgabe des Chefs, sich um den Purpose zu kümmern. Wer kümmert sich dann aber um die Fertigung von Laserschneidemaschinen oder Migräne-Medikamenten, wenn der Chef mit dem Purpose beschäftigt ist?
Meistens reicht die Bestimmung des Purpose dann doch nicht viel weiter als zu einem Abklatsch von Fridays for Future-Rhetorik und gängigem Öko-Klima-Mainstream. Firmen, die früher ihre Freude daran hatten, sich im Wettbewerb voneinander zu unterscheiden, wollen plötzlich alle das Gleiche: nachhaltig sein, das Klima schützen und ein bisschen gut sein. Ob sie es schaffen, die Marktführer in diesem Business – vom Nabu über Greta Thunberg bis zum Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung – in den Schatten zu stellen, darf bezweifelt werden.
Man kann sich den Spaß machen, die Seite der Pleite- und Betrugsfirma Wirecard zu besuchen. Auch dort hat man sich einem nachhaltigen Purpose verpflichtet: Man wolle nämlich der »leading innovative driver« werden und lege zudem größten Wert auf Transparenz. Dann das sei nötig, um Vertrauen zu schaffen. Das ist, wie man inzwischen weiß, bei Wirecard bislang gründlich schief gegangen: Milliarden Euro verschwanden auf intransparenten Konten in Asien, während sich ein führendes Vorstandsmitglied mit zwielichtigen Leuten des russischen Geheimdienstes herumtrieb, um dadurch seine Geschäftspartner zu beeindrucken. Eine etwas andere Art von Purpose, wenn man so will.
Nun soll keinesfalls behauptet werden, dass sich hinter all den »höheren Zielen«, denen sich die Firmen verschreiben, in Wahrheit Lug und Trug verbergen. Der Verweis auf Wirecard macht lediglich deutlich, dass solche Purpose-Bekenntnisse wertlos sind, weil sie der Bürger nicht überprüfen kann. Ob ein Sportschuh von Adidas gut sitzt, nicht drückt, und lange hält, also nachhaltig ist, kann ich als Wanderer überprüfen. Ob Adidas aber vermag, »durch Sport das Leben der Menschen zu verändern«, lässt sich schwerlich überprüfen und klingt arg großmäulig. Erst recht lässt sich die Behauptung der Purpose-Verkäufer nicht überprüfen, Firmen mit »höheren Zielen« verzeichneten einen höheren Aktienkurs als die kleinen Krauter, die die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt haben.Der »Markt für Tugend« wächst
Aber natürlich gibt es eine verführerische Logik hinter der Purpose-Mode, die sie unter wechselnden Etiketten (»Sozialverantwortung«, »Stakeholder-Wirtschaft«) noch lange am Leben halten wird: Es existiert neben dem Markt für Dübel, Autos oder Lago-Maggiore-Krimis auch ein »Markt für Tugend«, der in Zeiten eines aufgeheizten Moralismus-Klimas ständig wächst. Das ist ein weitgehend symbolischer Markt »imaginierter Zukunft« (Jens Beckert), der suggeriert, wir könnten durch gute Gesinnung die Welt besser machen. Wenn es freilich ernst wird, wie bei dem ominösen Lieferketten-Gesetz, das deutsche Firmen dazu verpflichten will, die finanzielle Verantwortung für Moral und Öko-Korrektheit bis tief nach Bangladesch zu übernehmen, dann ist den meisten Unternehmen ihr Hemd dann doch näher als der Purpose.
Höchste Zeit, die Luft aus dem rhetorischen Tugend-Markt herauszulassen. Gegen das Purpose-Geschwurbel hilft der alte Chicago-Ökonom und Nobelpreisträger Milton Friedman (1912 bis 2006). In seinem Buch »Kapitalismus und Freiheit« hatte er eine einfache Antwort auf die Frage nach dem Unternehmenszweck – den Gewinn. »Es gibt nur eine einzige soziale Verantwortlichkeit von Unternehmen – ihre Ressourcen zu nutzen und sich in solchen Aktivitäten zu engagieren, die den Gewinn steigern«, heißt es bei Friedman. Zugespitzt lautet sein Imperativ: »The social responsibility of business is doing business. « Oder auf gut deutsch: Schuster bleib bei Deinen Leisten!
Liest man Friedman lediglich als kalten Turbo-Kapitalisten, hätte man ihn grob missverstanden. In Wirklichkeit geht es ihm um eine Polemik gegen den Manager-Kapitalismus und um ein Plädoyer für den Steuerstaat und die Zivilgesellschaft. Manager, die das Geld der Firma (»other people’s money«) für »höhere Zwecke« (mit entsprechend höheren Personal- und Beraterkosten) ausgeben, wollen sich damit in ein moralisch gutes Licht stellen. Sie stabilisieren ihre Macht mit Geld, das entweder ihren Aktionären oder ihren Arbeitern oder ihren Kunden fehlt – zum Ausbau des eigenen Manager-Ruhms. Friedman interpretiert diesen »Raub« als eine Art von privater Steuer, welche die Manager für sogenannte gesellschaftliche Aufgaben für sich abzweigen. Traue keinem Manager, wenn er sagt, er widme sich dem Gemeinwohl! Das ist nicht sein Business. Wenn die Unternehmen gute Gewinne machen, dann befähigt das den Staat (mit Steuern) oder die Wirtschaftsbürger (mit Einkommen), Gutes, Klima-Nachhaltiges oder sozial Sinnvolles zu tun. Eine bessere Welt ist durchaus möglich; »höhere Zwecke« für Unternehmen braucht es dafür nicht.
Rainer Hank
