Hanks Welt
Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).
Aktuelle Einträge
13. Februar 2026Freie Rede
13. Februar 2026Was heißt da spätrömische Dekadenz?
02. Februar 2026Tax the rich
02. Februar 2026Frommer Neoliberalismus
17. Januar 2026Yoga auf Rezept
17. Januar 2026Kanzler-Populismus
16. Januar 2026Larry Summers' tiefer Fall
16. Januar 2026Bohrtürme, Windbeute, Gutmenschen
17. Dezember 2025Mehdorn war's nicht
15. Dezember 2025Folterwerkzeuge
28. September 2024
Reagan hätte nie für Trump gestimmt
Eine Portion Angebotspolitik würde der Welt nicht schaden
Ronald Reagan, US-Präsident von 1981 bis 1989, hat bei den Deutschen keinen guten Ruf. Ein drittklassiger Schauspieler – kleine Nebenrollen und Werbefilmchen – wollte plötzlich die Hauptrolle in der amerikanischen und internationalen Politik spielen: Dass das nicht gutgehen konnte, wusste der amerikakritische Dünkel der Deutschen schon vor Reagans Amtsantritt. Und dann entpuppte der Mann sich auch noch als ein »Neoliberaler«, der auf den Markt setzt und den Staat auf seine Kernaufgaben zurückstutzen wollte. Damit hat Reagan (1911 bis 2004) bis heute jede Sympathie verspielt.
Der Reagan-Hass der Deutschen von damals, so kommt es mir vor, unterscheidet sich kaum vom Anti-Trump-Furor heute. Dabei haben die beiden Republikaner nur wenig miteinander gemein. Dazu später mehr.
Die Abwertung Reagans ist schon deshalb daneben, weil sie ausgeblendet, dass dem Mann große Verdienste zukommen für die Ermöglichung der deutschen Einheit. Am 12. Juni 1987 hielt er von einem Holzgerüst, welches vor den Sperranlagen der Berliner Mauer am Brandenburger Tor aufgebaut worden war, eine Rede, in der er den sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow aufforderte, die Mauer niederzureißen: »Come here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall.« 1987 – das war eine Zeit, als die (West)deutschen das Interesse an der Wiedervereinigung längst verloren hatten. Und man mit Reagans »Antikommunismus« fremdelte.
Auch ein Rückblick auf Reagans Wirtschaftspolitik, schon damals »Reagonomics« genannt, könnte heute hilfreich sein. Dieser Blick zurück macht zum einen deutlich, wie dramatisch die Welt in diesen 45 Jahren sich geändert hat. Und er wirft die Frage auf, ob angesichts des drohenden wirtschaftlichen Niedergangs Deutschlands uns ein anständige Portion Reagonomics nicht guttäte.
Die Stunde der liberalen Ökonomen
Die Situation Deutschlands und Amerikas in den späten siebziger Jahren war der heutigen nicht unähnlich. Hohe Inflation bei wirtschaftlicher Stagnation, wofür der Begriff »Stagflation« erfunden wurde, brachte die post-keynesianische Wirtschaftspolitik in die Bredouille. Politische Interventionen in unternehmerisches Handeln, Nachfragesteuerung über Konjunkturprogramme und eine laxe Geldpolitik verfehlten die erwünschte Wirkung. Neue Ideen waren gefragt: Das war die Stunde liberaler Ökonomen; viele von ihnen lehrten an der Universität Chicago. Denen ging es nicht nur darum, Nachfragepolitik durch Angebotspolitik zu ersetzten, sondern – mit einem von Lenin entlehnten Begriff der Historiker Daniel Yergin und Joseph Stanislaw – die »Kommandohügel« neu zu besetzen: Markt statt Staat.
Politiker weltweit begannen in ihrer Not diesen liberalen Ökonomen zuzuhören. Schon im Sommer 1979 hatte der demokratische Präsident Jimmy Carter (er wird am 1.Oktober 2024 hundert Jahre alt) eine »nationale Vertrauenskrise« ausgerufen und Mitglieder seines Kabinetts entlassen. Gleichzeitig ernannte Carter einen neuen Zentralbankpräsidenten, den erfahrenen Geldexperten Paul Volcker. Dessen Mission wurde es, »den Drachen der Inflation zu erschlagen«, was ihm mit drastischen Zinserhöhungen in kurzer Zeit gelang.
Die Früchte dieser Geldpolitik erntete Ronald Reagan, der im Januar 1980 ins Weiße Haus einzog und auch in den USA unterschätzt wurde. Man hielt ihn für unerfahren und unzuverlässig, obwohl er acht Jahre lang Gouverneur von Kalifornien gewesen war, fremdelte mit ihm, weil er ankündigte, er werde den Staat zurückdrängen, staatliche Ausgabenprogramme kürzen und die Magie der Märkte feierte. Reagan galt als Außenseiter und Leichtgewicht.Unterschätzt zu werden ist häufig ein Vorteil, man denke an Angela Merkel. Reagan zog sein Programm radikal durch. Sowohl Steuern als auch Ausgaben wurden gesenkt, freilich um den Preis einer dramatischen Ausweitung der Staatsschulden. Der Spitzensteuersatz wurde von 70 auf 28 Prozent gesenkt, die Besteuerungsbasis verbreitert, viele Steuerschlupflöcher gestopft. Zugleich hat man viele Branchen (Energie, Börsen, Luftfahrt) dereguliert: Mehr Wettbewerb, weniger staatlich vorgegebene Regulierung und Bürokratie. Dahinter stand die Überzeugung: Freihandel (ohne Zölle und Subventionen) mache die Völker reich und die Welt friedlicher. Regans Politik war liberal und konservativ, aber nicht nationalistisch. Er war kein Ideologe, sondern agierte pragmatisch und war zu Kompromissen bereit.
Erst wenn man Reagans Politik auf diesen Kern konzentriert, fällt auf, wie weit die Welt sich von damals wegentwickelt hat. Zölle gelten inzwischen als probate Waffe in Handelsauseinandersetzungen. Staatliche Subventionen in Milliardenhöhe sollen Standorte im Wettbewerb stärken und werden als geoökonomische Realpolitik schöngeredet. Deregulierung wird rhetorisch zu »Bürokratieabbau« gestutzt, dem keine Taten folgen. Von Steuersenkungen ist nicht mehr die Rede. Einschränkung staatlicher Ausgaben wird als »sozialer Kahlschlag« tabuisiert.
Protektionismus hat Konjunktur
Protektionistische und interventionistische Normalität ist kein deutsches Sonderphänomen. Sondern gehört in vielen westlichen Ländern inzwischen zum gepflegten Ton. Auch in den USA unter Präsident Biden; Kamala Harris würde daran nichts ändern. In Deutschland versteht es Wirtschaftsminister Robert Habeck, die alten Hüte des Interventionismus als neuesten philosophischen Schrei zu verkaufen: Es sei seine Aufgabe, strategisch wichtige Branchen mit Milliardensubventionen zu stabilisieren. Subventionitits total: Vom Schiffbau, über die Auto- bis zur Chipindustrie. Dies hätten Ronald Reagan und seine Vordenker als anmaßende Hybris und Ausdruck der Schwäche gebrandmarkt.
Es zeigt sich zugleich, wie weit Reagan und Trump voneinander entfernt sind, obwohl Trump sich gerne in die Tradition Reagans stellt, weil er weiß, dass dieser bei den republikanischen Wählern inzwischen einen guten Ruf genießt. Doch wirtschaftspolitisch setzt Trump auf Isolationismus, Protektionismus und Interventionismus. Die »neoliberale« Welthandelsorganisation, deren Auftrag der Abbau globaler Handelshemmnisse ist, hält er für Teufelszeug, eine Politik, die dem nationalen Interesse Amerikas (MAGA) schade.
Reagan wusste zu unterscheiden, wer Amerikas Freund und wer Amerikas Feind ist. Bei Trump ist man sich da nie sicher. Er steht zwar an der Seite Israels, nannte aber zugleich die Hisbollah »very smart«. Er flirtet mit Autokraten wie Wladimir Putin, dem er zum Wahlsieg gratuliert – anstatt auszusprechen, dass Wahlen in Russland eine Farce sind und mit Demokratie nichts zu tun haben. Bekanntlich hat Trump mit der Anerkennung demokratischer Wahlen auch im eigenen Land seine Probleme. »Reagan hätte nie für Trump gestimmt«, schreibt ein alter Weggefährte Reagans im »Wall Street Journal«. Der Mann hat Recht.
Rainer Hank
10. September 2024
Das Ende der Ampel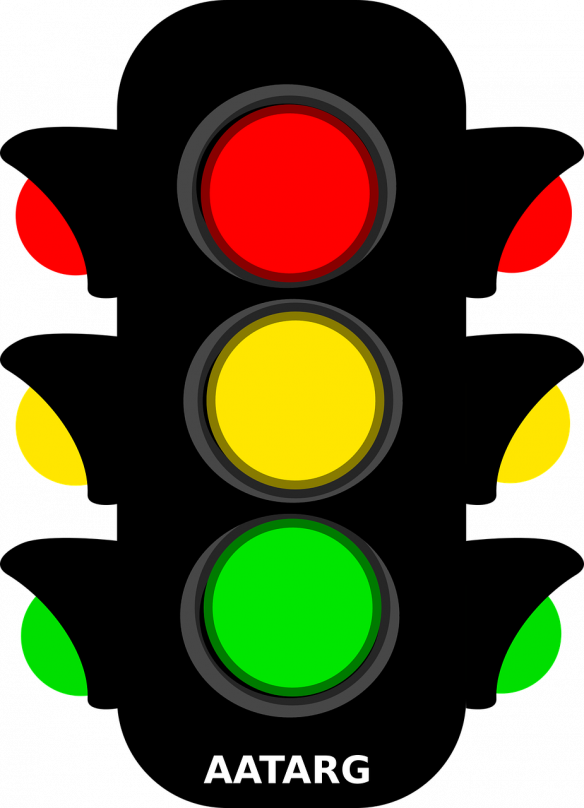
Wie konnte es dazu kommen? Frag die Spieltheorie!
Der Ampel schägt die letzte Stunde. Wie konnte es so weit kommen? Zu sagen, das läge an der Dauerstreitereien von SPD, Grünen und Liberalen, greift zu kurz. Womöglich war es eher der anfängliche Konsens und ein initialer Schulterschluss zwischen Grünen und FDP, der der Ampel jetzt zum Verhängnis wird.
Ein Blick zurück zu den Bundestagswahlen 2021 lohnt. Betrachtet man die Verteilung der Sitze, rangierten auf Platz Eins die Sozialdemokraten. An zweiter Stelle stand die Union. Erst an dritter und vierter Stelle kamen Grüne und FDP. Man hätte deshalb erwarten können, dass es zu einer umgekehrten großen Koalition unter Führung der SPD gekommen wäre gemäß »Gamsons Gesetz«, wonach politische Macht in einer Regierung proportional zu den Stimmanteilen verteilt wird. Doch die Sozialdemokraten hatten nach drei Legislaturperioden mit Kanzlerin Angela Merkel die Lust auf die CDU/CSU verloren und eine abermalige »große« Koalition kategorisch ausgeschlossen. Damit freilich hatte sich die SPD verhandlungsstrategisch ohne Not selbst geschwächt.
Weil durch die SPD-Festlegung die beiden kleineren Parteien für eine Mehrheit dringend benötigt wurden, haben diese den Spieß umgedreht und sind wie die eigentlichen Wahlsieger aufgetreten. Robert Habeck und Christian Lindner rissen das Heft des Handelns an sich. Geschickt verstanden FDP und Grüne es, sich als die »Koalition der Gewinner«, der »Jungen« und der »Fortschrittlichen« darzustellen. Kein Blatt sollte zwischen Habeck und Lindner passen.
Das muss man sich in Erinnerung rufen, weil es aus heutiger Sicht wie aus einer fremden Welt tönt. In der heutigen Welt sagt Habeck: »Sollte ich jemals Bundeskanzler werden, wird Christian Lindner nicht Finanzminister werden.« Man darf in diesem Satz die Namen Lindner und Habeck risikolos vertauschen.
Die Ampelregierung war für Deutschland in mehrfacher Hinsicht ein gewagtes Experiment, was damals gar nicht richtig aufgefallen ist. Neu ist erstens, dass nach der Serie der großen Koalitionen die Regierungsmehrheit nicht proportional zu den Stimmenanteilen verteilt wurde, mithin Gamson’s Gesetz nicht gilt. Zweitens wird die Bundesrepublik zum ersten Mal in ihrer Geschichte von einer Koalition aus drei Parteien regiert. Ungewöhnlich ist zudem drittens, dass diese drei ideologisch denkbar weit auseinander liegen. Koalitionen werden üblicherweise von ideologischen Nachbarn geschmiedet.
Kooperieren oder nicht kooperieren?
Wie konnte es nun aber zur Zerrüttung des Bündnisses kommen und zur Abwanderung der Ampel-Wähler und dem Erstarken der extremen Ränder?
Ich versuche es mit einer Erklärung der ökonomischen Spieltheorie. In der Spieltheorie – stark vereinfacht für diese Kolumne – geht es darum, ob es für Akteure besser ist zu kooperieren oder nicht zu kooperieren. Die Antwort wird nicht moralisch entschieden (»Gute Menschen kooperieren«), sondern utilitaristisch: Bringt kooperieren oder nicht kooperieren den größeren Nutzen und Vorteil für den jeweiligen Akteur? Die Frage, was normativ die bessere Politik wäre (mehr oder weniger Sozialstaat, mehr oder weniger Umweltpolitik) ist spieltheoretisch ohne Belang.
Thomas König, ein Professor für Politikwissenschaft an der Universität Mannheim und Fachmann für Spieltheorie, hat gerade eine Studie über das Regieren in Koalitionen abgeschlossen (»Coalition Governance. Learning to Govern Together. Oxford University Press«), die mir die Augen geöffnet hat. Die zwei Jahre Ampel-Regierung sind für den Forscher ein Paradebeispiel für den Umschlag von Kooperation zu Nicht-Kooperation. Und dafür, was so etwas mit den Bürgern macht.
König argumentiert wie folgt: Trotz aller ideologischer Positionsunterschiede der Ampelkoalitionäre konnten diese zu Beginn der Regierungszeit erstaunliche Erfolge bei der Krisenbewältigung gemeinsam erzielen. Insbesondere die Grünen stiegen in der Gunst der Wähler, weil sie entgegen ihrer Ideologie nach dem Energieschock Flüssiggasterminals (LNG) und eine zumindest kurzfristige Verlängerung der Atomlaufzeit unterstützten. Daraus, so König, konnte der Wähler schlussfolgern, dass das notwendig und richtig war, wenn selbst die Grünen dafür ihre Ideale opferten.
Doch dann kam die Wende: Von der Kooperation profitierten zu Beginn der Legislaturperiode ausschließlich die Grünen, während SPD und FDP in der Wählergunst stark abfielen – was in einer Koalition Streit befördert, weil man dem glücklichen Partner den Gewinn missgönnt und seine Vorschläge kritisiert, so dass der Wähler schlussfolgert, dass diese nicht notwendig oder gar richtig waren. So gesehen wäre es kein Zufall, dass SPD und FDP mit aller Macht die Inkompetenz der Grünen beim Heizungsgesetz (»Wärmepumpe«) öffentlichkeitswirksam beschworen haben (BILD: »Habecks Heizungs-Hammer«), woraufhin die Wähler die Grünen abstraften, wovon freilich die anderen Koalitionäre als Teil der Regierung nicht profitieren konnten.
Eingesperrt im Gefangenendilemma
Dass die Ampel-Koalitionäre in ihren Honeymoon-Wochen enge Kooperation gelobten und versprachen, einander den jeweiligen Erfolg nicht zu neiden, muss man im Nachhinein als Lippenbekenntnis deuten. Den Typus einer Koalition (ob kooperativ oder unkooperativ) erkenne man erst, wenn es mit dem Regieren losgegangen ist und nicht an den Absichtserklärungen des Koalitionsvertrags, sagt Thomas König.
Seit dem Heizungsgesetz gehen nun alle Ampelkoalitionäre davon aus, dass eine unkooperative Partnerschaft besteht – und verhalten sich entsprechend. Das führt dazu, dass das Timing von Regierungsvorlagen verschleppt wird, weil die Kosten einer unkooperativen Koalition höher als die Gewinne erachtet werden, die man durch frühzeitige Umsetzung der gemeinsamen Regierungsagenda erzielen kann. Es entsteht schließlich in der Wirtschaft, den Medien und der Bevölkerung der Eindruck, dass man nicht vorankommt und jeweilige Vorschläge bewusst torpediert und dadurch verschleppt werden. Daraus schlussfolgert der Wähler, dass diese weder notwendig noch richtig sind, was vor allem AfD und BSW mit ihrer Generalkritik ausschlachten und bei den Wahlen in Thüringen und Sachsen als Erfolg verbuchen können.
Das Fazit ist bitter: Die Ampel-Akteure haben sich in ein Gefangenendilemma hineinmanövriert. Obwohl die Regierung (und die Bürger) von Kooperation profitieren würden, ist für jeden einzelne der drei Parteien nicht zu kooperieren rational. Schwindende Wählerakzeptanz führt (noch) dazu, dass keiner der Akteure durch einen Ausstieg aus der Koalition seine Lage verbessern würde (»Locked-In Syndrom«). Schon beginnen Teile der Ampel, sich der Union anzudienen: Grünen-Chef Nouripour diskreditiert die Ampel als »Übergangsregierung«, Kanzler Scholz geht nach dem Terror von Solingen als erstes auf Oppositionsführer Merz zu. Derartige Kapriolen werden die Ampel weiter zersetzen.
Rainer Hank
27. August 2024
Streit ist das Wesen der Demokratie
Doch leider weiß die Ampel nicht, wie das geht
Die Ampel streitet. Das ist keine überraschende Meldung. Sondern der Normalfall der aktuellen Regierungskoalition. Die Sommerwochen waren geprägt von einem Haushaltsstreit um Milliardeneinsparungen, bei denen jedes Ressort der Meinung war, am besten sei es, das Nachbarressort würde sparen. Noch besser natürlich wäre es, man dürfe mehr Schulden machen. Dann müsste keiner sparen. Inzwischen verharren die Koalitionäre in einer Mischung aus Lethargie und Depression.
Streit kommt bei den Bürgern schlecht an. Wenn Regierungen sich streiten, verlieren sie an Zustimmung in den Umfragen der Meinungsforscher. Das ist verständlich, rührt vermutlich aus unserer Kindheit. Wenn Kinder sich streiten, schimpfen die Eltern. Die FDP-Koalitionäre benähmen sich »wie bockige Kinder«, heißt es. Kommentatoren erinnern den Kanzler an seinen Satz: »Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch.« Na, so was, und jetzt haut er nicht auf den Tisch, der Schwächling. »Wir brauchen einen starken Politiker an der Spitze, keine endlosen Debatten und Kompromisse«, sagen 60 Prozent der Bürger in Ost-, aber auch 49 Prozent der Leute in Westdeutschland. So steht es in der jüngsten Allensbach-Umfrage für die FAZ vom 22. August.Der Wunsch nach »Führung« durch einen starken Mann offenbart ein merkwürdiges Demokratieverständnis. Man könnte es den autoritären Charakter nennen. Machertypen sind gefragt, die sagen, wo es lang geht und dafür sorgen, dass alle an einem Strang ziehen. Es sind dieselben Stimmen, die uns täglich mit besorgter Miene davor warnen, die Populisten von AfD oder BSW wollten die Demokratie abschaffen und den Autoritarismus oder gar den Faschismus einführen, die von den derzeit regierenden Demokraten Autoritarismus fordern und den Konflikt als Kleinkinderei kritisieren.
Den »autoritären Charakter« gibt es auch bei Demokraten
Wer die liberale Demokratie verteidigen will, muss den Konflikt verteidigen und sich über den Streit freuen. Kompromissfindung ist mühselig. Doch so funktioniert das politische System. Um Mehrheiten zu bilden, braucht es Koalitionen unterschiedlicher Parteien mit unterschiedlichen ideologischen Ausrichtungen. Man könnte eine Koalition eine Institution zur Internationalisierung von Opposition innerhalb eines Regierungsbündnisses nennen. Dass der FDP regelmäßig vorgeworfen wird, sie verhalte sich wie die Opposition in der Regierung, wäre, so gesehen, systembedingt und systemgewollt. Und nicht einer destruktiven Lust an der Blockade geschuldet. Wer die binnenkoalitionäre Opposition nicht will, muss ein Mehrheitswahlrecht einführen (wie in Großbritannien oder den Vereinigten Staaten). Da nimmt sich der Sieger alles und kann durchregieren. Das wollten die Deutschen ja gerade nicht, weil sie ihre Neigung zum Autoritären zu kennen und sich durch ein Verhältniswahlrecht gegen ihre historische Charakterschwäche schützen wollten.
Koalitionen sind teuer. Je mehr Parteien eine Koalition bilden, umso kostspieliger wird es am Ende für den Steuerzahler. Denn jeder der Koalitionäre muss seiner Wählerklientel beweisen, dass er etwas für sie herausgeholt hat. Sonst hätte die Stimme an der Wahlurne keine Rendite abgeworfen und man könnte das nächste Mal gleich die anderen wählen.
So viel zur politischen Theorie. Jetzt zur politischen Praxis der Ampel. Mein Eindruck ist, dass das rot-grün-gelbe Bündnis bei seinem Gründungsakt selbst nicht wusste oder nichts davon wissen wollte, dass Koalitionen zu Konflikt und mühsamer Kompromissfindung verdammt sind. Zum Beweis reicht ein Blick in den Koalitionsvertrag (144 Seiten!), in dem es von Konsenspathos nur so trieft. »Mehr Fortschritt wagen«, so lautete das Motto, mit dem man Deutschland und den Deutschen eine Art Paradies auf Erden versprach. Die Dreiparteientruppe meinte, sich den Konflikt sparen zu können, um gleich mit dem Weltverbessern zu beginnen.
Dumm nur, dass sich rasch herausstellte, dass man unterschiedliche Vorstellungen hatte, wie die Welt zu verbessern sei. Der SPD war es vor allem um den weiteren Ausbau des ohnehin schon üppigen Sozialstaats zu tun. Bürgergeld (in Wirklichkeit Stütze ohne Gegenleistung), Kindergrundsicherung, Rentenversprechen ohne Rücksicht auf demographische Finanzierungsnot), satte Mindestlöhne: Vorhaben, die viel Geld kosten und selbst durch die »Zeitenwende« keiner Korrektur unterzogen werden durften. Weltverbesserung mit dem Kopf durch die Wand.
Getoppt wurde das von den notorisch zur Bürgerbevormundung neigenden Grünen: Eine CO2–neutrale Welt, möglichst übermorgen, braucht weder klimaneutralen Atomstrom noch Gas oder Kohle. Eine schöne neue Welt, flächendeckend überzogen von E-Autos, Fahrrädern und Wärmepumpen. Teuer, aber wer wird kleinkrämerisch übers Geld reden.
Die FDP stimmt erst zu und widerrurft später
Im Konsensdusel des zauberhaften Anfangs hat die FDP unterschrieben, was sie eigentlich nicht wollen konnte, nämlich all die von SPD und Grünen versprochenen Wohltaten. Und dazu einen Haushaltstrick zur Umgehung der Schuldenbremse mitgetragen, den später das Verfassungsgericht kassiert hat. Darüber hinaus hat die FDP auch in Brüssel ziemlich viel ordnungspolitischen Unsinn mitgetragen (Lieferkettenverordnung, Renaturierungsgesetz).
Als die FDP mit Blick auf ihre Wähler endlich aufwachte und zu opponieren begann, wargen die teuren Beschlüsse meist schon auf dem Weg vom Kabinett ins Parlament. Dass dies kognitive Dissonanzen zu erkennen gibt, die von Rot und Grün in der Koalition liebevoll-boshaft ausgespießt werden, nimmt nicht Wunder. Die Widersprüche ermöglichen es, die Liberalen als eine Blockadetruppe öffentlich zu geißeln, die sich von der Fortschrittspolitik angewandt habe. In Wirklichkeit hätte sich die FDP nie dafür hergeben sollen, eine Politik des üppigen Sozialstaatsausbaus und der überteuerten Klimatransformation Fortschritt zu heißen. Sie hätte besser nie den üppigen Subventionen an die Großindustrie zugestimmt, die den Standort nicht stärken, sondern seine Schwäche offenbaren. Erst mitmachen und hinterher mosern – schwierig.
Zurück zum Streit. Die parlamentarische Opposition kann sich Fundamentalwiderstand leisten, muss es womöglich tun, um auf dem Weg zur Entmachtung der Regierung ihre Alternativen deutlich zu machen. Opposition innerhalb in einer Koalition kann nicht darin bestehen, an Maximalpositionen trotzig festzuhalten oder – wie im Fall der FDP – mal hü mal hott zu sagen. Denn dann gerät der Fluchtpunkt des Konflikts aus dem Blick: Die Kompromissfindung.
Nicht dass sie streitet, ist das Problem dieser Regierung. Sondern, dass sie schlecht streitet. Und dass sie zu spät mit dem Streit angefangen hat. Jetzt ist nichts mehr zu retten. Aus der »Übergangsregierung« (Omid Nouripour) ist eine Untergangsregierung geworden.
Rainer Hank
27. August 2024
Lauter Vizepräsidentinnen
Titel sind wichtiger als man denkt
Der wichtigste Direktor der Stuttgarter Bank, in der ich aufgewachsen bin, hieß von Varnbüler. Als Kind habe ich ihn nie zu Gesicht bekommen, nur sein Büro nach Feierabend, wenn ich mit meinem Vater, dem Hausmeister, durch die Räume der Bank streunen durfte. Dass Herr von Varnbüler – für mich hatte er keinen Vornamen – der wichtigste Mann der Bank war, sah man schon daran, dass sein Büro das größte im ganzen Haus war. Sein Schreibtisch auch.
Es gab auch noch andere Direktoren in der Bank. Die waren auch wichtig. Das hörte ich daran, wie achtungsvoll mein Vater von ihnen sprach. Er sagte immer »der Direktor Dölger«. Nie hätte er gesagt, »der Dölger«. Auch nicht, wenn wir unter uns waren. So habe ich als Kind gelernt, dass Hierarchien in einer Firma wichtig sind. Und dass man die Wichtigkeit der Menschen am Titel erkennt, den einer hat. Es gab auch Prokuristen. Das klang geheimnisvoll, obwohl die, glaube ich, nicht so wichtig waren.
Die Erinnerung aus der Kindheit kam mir, als ich kürzlich in der FAZ las, dass der DWS, die Fondgesellschaft der Deutschen Bank, Titel wiedereinzuführen beabsichtigt. Mir war ehrlich gesagt entgangen, dass man die im Jahr 2020 abgeschafft hatte. Es sollten »hierarchische Barrieren« eingerissen werden. Ein »agiles« Unternehmen, wie man das zu nennen pflegt, wolle Leistung betonen. Ohne Titel könnten sich Mitarbeiter auf Augenhöhe begegnen. Das scheint offenbar nicht gut angekommen zu sein. Und zwar gerade bei den Mitarbeitern selbst, denen man eigentlich etwas Gutes tun wollte, was sicher auch damit zusammenhängt, dass die DWS nicht nur die Titel, sondern auch Beförderungen abgeschafft hat, mit denen automatisch Gehaltserhöhungen verbunden waren. Plötzlich, wie gesagt, sollte ausschließlich die Leistung das Gehalt bestimmen.
13 Joblevel sind auch keine Alternative
Die DWS war übrigens nicht allein. Auch der Versicherungskonzern Axa hat in der Schweiz Titel abgeschafft, weil die als »Statussymbole« nicht mehr zeitgemäß seien. Stattdessen gibt es dort jetzt 13 Joblevel. Da wäre ich dann also auf Level 7 wichtiger als der Kollege auf Level 6, aber weniger wichtig als Kollege Level 8: »New Work« heißt so etwas heutzutage. Für mich klingt es eher nach Brave New World von Aldous Huxley. Bei der DWS jedenfalls kommen sie jetzt wieder zum »Director« zurück. Besonders gerne genommen werde der »Managing Director«, mit dem eine Bereichsleitung verbunden ist, die direkt unter dem Vorstand angesiedelt ist.
Anders als in meiner Kindheit sind die Titel in deutschen Unternehmen heutzutage englisch. Mein Vater wäre jetzt kein Hausmeister mehr, sondern ein »Facility Manager«. Ob ihm das recht wäre? Als mir vor Jahren als junger Journalist ein Interview mit einem Vice President angeboten wurde, war ich stolz und dachte, das müsse der zweitwichtigste Mann des Konzerns sein. Meine Enttäuschung war groß, als ich hörte, dass es in diesem Unternehmen 30 Vice President gibt.Mit der Titel-Inflation differenzieren sich die Titel. Und man muss die Übersetzung kennen. Ein »senior vice president« ist ein Angestellter im mittleren Management. Ein »assistant vice president« hat vor drei Jahren die Universität verlassen. Und ein »associate vice president« hat gerade das Alphabet gelernt, spottete der »Economist«. Wenn man jemanden unter den Vizepräsidenten besonders auszeichnen will, sollte man ihn mindestens zum »Senior executive vice president« befördern. So ist es bei einer Inflation: Wert und Bedeutung von Titeln verfallen im Maße ihrer personalpolitischen Vermehrung.
Der amerikanische Präsident hat nur eine einzige Vizepräsidentin. Auch die war vier Jahre lang unwichtig. Ich habe zufällig mitbekommen, wie Kamala Harris die Ankunft eines amerikanischen Mammutbaums in einem botanischen Garten Singapurs mit ihrer Anwesenheit aufwerten durfte. Dass es jetzt so aussieht, als werde sie demnächst die Welt erlösen und die Demokratie retten, hat jedenfalls nichts damit zu tun, dass sie Vizepräsidentin ist. Bei uns in Berlin haben wir zwei Vizekanzler. Das weiß kaum einer: Der Senior »Vice Chancellor« heißt Robert Habeck. Der »Associate Vice Chancellor« heißt Christian Lindner. Dass die beiden wichtig sind, sieht man daran, dass sie sich streiten. Dass sie sich streiten hat vor allem damit zu tun, dass sie verschiedenen ideologischen Ampel-Fraktionen angehören. Mit ihrem Amt als Vize-Kanzler hat es nichts zu tun.
Vorbild aller Hierarchien ist entweder das Militär oder die Verwaltung. In Österreich hieß es lange Zeit »Ja grüß Gott, Frau Medizinalrat«, wenn man die Gattin desselben begrüßte. Einer aktuellen Serviceseite »Wie Sie Titel in Österreich richtig verwenden« entnehme ich, dass das so etwas heute nicht mehr üblich sei. Aber Professoren am Gymnasium und Doktoren sollte man schon so ansprechen: 70 Prozent der Österreicher legen Wert auf Titel und benutzten sie auch, heißt es auf der Seite.
Chefkorrespondenten sind auch nicht mehr, was sie mal waren
In einer inzwischen üblichen allgemeinen Duz-Kultur wird der Doktor kaum überleben. In Amerika orientieren sich die Unternehmen am Militär, weshalb es in der Hierarchie von Offizieren nur so wimmelt – eine ähnliche Vervielfachung wie bei den Vizepräsidenten.Es gibt nicht nur den CEO, den »Chief Executive Officer« (in Deutschland hieß er früher »Vorstandsvorsitzer«[sic]), sondern auch den CIO, den Chief Innovation Officer, als ob man Innovation militärisch befehlen könne. Mir persönlich gefällt der CDEIO besonders gut: Das ist der Chief Diverstiy, Equity and Inclusion Officer. Lauter Chefs. Vorlage für die Konstruktion Chief plus Officer ist, wie gesagt, das amerikanische Heer, wo es für jede Division einen kommandierenden Officer gibt, lese ich. Mir fällt dazu immer nur Officer Krupke ein. Das ist jener Polizei-Sergeant aus der West Side Story, den die Jugendgangs so wunderbar nachäffen. Sein Vorgesetzter heißt übrigens Lieutenant Schrank.
Sagen wir es so: Titel abschaffen bringt nichts. Man braucht sie, um nach außen und innen zu signalisieren, wofür jemand zuständig ist, und wer Ober und wer Unter ist. Das Machtgefälle verschleiernd nennt man das »wer an wen berichtet«. Außerdem taugen Titel als Epauletten. Das kommt ebenfalls aus dem Militär und bezeichnet die Schulterklappe an einer Uniform. Unternehmen verteilen Epauletten, wenn sie kein Geld für Gehaltserhöhungen haben, aber jemanden symbolisch aufwerten wollen, sei es, um zu verhindern, dass er zur Konkurrenz abwandert, oder um ihn anzuwerben, obwohl gar keine Abteilungsleiterstelle (altmodischer Begriff) frei ist. Mich wollte mal vor Jahren ein Medienunternehmen als Chefkorrespondent einstellen. Zum Glück habe ich in letzter Minute gemerkt, dass ich weder Korrespondent (New York, Rio, Tokio) würde, noch irgendein Chef wäre. Da gefällt mir der Titel »FAS-Kolumnist« doch viel besser.
Rainer Hank
14. August 2024
Wie umgehen mit Populisten?
Im Zwispalt zwischen elektroaler und liberaler Demokratie
Ampel-Regierung und Unionsopposition haben sich darauf geeinigt, das Bundesverfassungsgericht vor einem Angriff von Autokraten und Populisten zu schützen. Das wurde in der Öffentlichkeit ziemlich unisono als Stärkung der Demokratie kommentiert und als Vorsorge für den Fall, dass sich die politischen Mehrheitsverhältnisse in Deutschland ändern sollten – im Klartext: dass die AfD bei den kommenden Wahlen weiter an Stimmen zulegen könnte.
Zweierlei fällt auf: Das Verfassungsgericht galt bislang als Bollwerk gegen die Versuchung von Politikern, mit ihren Mehrheiten zu machen, was ihnen in den Kram passt. Auch Demokraten sind nicht frei. Man denke an das Urteil zur Schuldenbremse, das die Verfassung durchgesetzt hat gegen Minister und Ökonomen, die das Urteil als juristische Knebelung der Demokratie ansehen. Und genauso ist es auch gemeint. Wenn das Verfassungsgericht solche Macht hat – warum muss es dann gestärkt werden? Womöglich ist der vorwegnehmende Akt in Wirklichkeit ein Ausdruck von Schwäche?
Gravierender noch ist zweitens die Paradoxie, wonach es eine Stärkung der Demokratie sein soll, wenn eine Institution vor geänderten Mehrheitsverhältnissen – mithin vor der Demokratie – geschützt wird. Demokraten haben Angst vor demokratischen Wahlergebnissen, die dazu führen könnten, dass sie entmachtet werden. Ist Entmachtungschance nicht das Wesen der Demokratie?
In Wirklichkeit geht es nicht um eine Stärkung der Demokratie, sondern um ihre Disziplinierung. Populisten sollen weniger Schaden anrichten können. Für die Befürchtung, dass sie das könnten, gibt es Gründe. Unredlich und unlogisch ist es, sich auf die Demokratie zu berufen. Denn vor der haben Ampel und Unionsopposition doch gerade Angst.
Der Liberalismus hat viele Feinde
Wenn es nicht um die Stärkung der Demokratie geht, sondern ihre Disziplinierung – man kann auch sagen ihre Schwächung –, worum geht es dann? Es geht um die Stärkung der Freiheit, also um Liberalität. Freiheit und Demokratie sind keine Synonyme, auch wenn das angesichts der ideologischen Überhöhung der Demokratie (als das Gute, Wahre, Schöne und Hochwertige) vielfach behauptet wird. Der Liberalismus hat viele Feinde, die Demokratie zählt dazu: Wenn das Volk mit Mehrheit entscheidet, kann die Freiheit (nicht nur die der unterlegenen Minderheit) auf der Strecke bleiben. Man muss sich also schon entscheiden, was man als obersten Wert ansieht: Freiheit und Liberalismus oder Mehrheitsprinzip und Demokratie. Ich wüsste, wofür ich mich entschiede, und will das heute aus der Ideengeschichte des Liberalismus heraus begründen.
Liberalismus setzt sich ein für eine Gesellschaft, in welcher niemand Angst haben muss. »Abwesenheit von Angst«, sagt die amerikanische Philosophin Judith Shklar (1928 bis 1992), ist die fundamentalste Freiheit, die es gibt. Wer Angst hat, ist nicht frei. Despoten pflegen ihre Untertanen zu ängstigen. Wenn sie sich dabei auf Gott berufen, umso schlimmer. Denn Religion kann Menschen in große Angst versetzen. Insofern hat sich der philosophische Liberalismus seit der Aufklärung gegen Machtanmaßungen des Staates zur Wehr gesetzt, einerlei, wie theokratisch oder säkular er sich legitimiert. Später ging es dann darum, die Freiheit gegen die Verlockungen von Revolution und Reaktion zu sichern, also gegen links wie rechts. Folgenschwer wurde ein innerliberales Schisma, zu dem es Ende des 19. Jahrhunderts gekommen ist: Während die »fortschrittlichen« Liberalen die Armut der Arbeiter als größte Bedrohung der Freiheit ansahen und vom Staat für sie sozialen Ausgleich forderten, war für die »klassisch« Liberalen diese Staatsgläubigkeit bereits der erste Schritt in Richtung Sozialismus. Seither stehen sich Linksliberale (»Liberal«) und klassisch Liberale (»Libertarian«) gegenüber.
Der Liberalismus gründete von Anfang an auf drei Säulen: auf politischer Freiheit, wirtschaftlicher Freiheit und auf eine Ethik der Freiheit. So kann man es in der Geschichte des Liberalismus nachlesen, die der britische Ideenhistoriker Alan S. Kahan gerade vorgelegt hat (»Freedom from Fear. An Incomplete History of Liberalism.« Princeton University Press). Politische Freiheitsrechte der Bürger müssen ergänzt werden durch wirtschaftliche Freiheit, die Eigentumsrechte und Verträge zwischen Marktteilnehmern sichert. Umstritten war stets, ob politische und wirtschaftliche Freiheiten durch ein ethisches Wertesystem ergänzt werden sollten, oder ob dies bereits ein ideologischer Übergriff wäre.
Den Staat vom Einfluss der Massen befreien
Dass die Demokratie die Freiheit bedroht, war den Liberalen (etwas bei Tocqueville oder J.S. Mill) stets bewusst. Besonders prominent kam die Gefahr den deutschen Ordo- oder Neoliberalen der »Freiburger Schule« in den Blick. »Der Staat muss die Stärke haben, sich selbst vom Einfluss der Massen zu befreien«, heißt es bei Walter Eucken. Der elitäre, antidemokratische Ton ist nicht zu überhören. Kein Wunder, dass Populisten aller Zeiten den Liberalismus (und nicht die Demokratie) als ihren Hauptfeind identifizierten. Mit der Demokratie haben sie weniger Probleme (Viktor Orbans »illiberale Demokratie«), mit dem Sozialismus auch nicht, blickt man auf die sozialpolitischen Programme von AfD oder BSW (»Bündnis Sahra Wagenknecht«).
Im Kampf gegen den Populismus geht darum, wie und woher der Liberalismus wieder neue Überzeugungskraft gewinnen kann. Naheliegend, aber nicht ungefährlich ist der rechtsstaatliche Weg, immer mehr Institutionen vor Mehrheitsentscheidungen abzuschotten. Der Vorwurf der Populisten, damit wollten die Herrschenden vor allem ihre Macht sichern, ist nicht von der Hand zu weisen. Im Namen der Freiheit demokratische Freiheiten einzuschränken, ist heikel. Ohnehin wird das die Populisten nicht daran hindern, liberale Institutionen (Gerichte, unabhängige Notenbank, freie Presse) zu schwächen, wenn sie an der Macht sind. Nicht minder problematisch ist der Vorschlag, der Liberalismus müsse seine ethischen oder gar religiösen Grundlagen stärken, um die Populisten mit einem freiheitlichen Sinnangebot zu schlagen. Auch die Populisten bedienen sich der Religion als Legitimationsinstanz: Putin hat seine Popen, Maduro und Trump haben ihre evangelikalen Charismatiker. Ideologische Charismatik ist nicht die Stärke des liberalen Bekenntnisses. Zum Glück.
Populismus ist eine demokratische Reaktion gegen den liberalen Legalismus. Der Liberalismus kann nicht mehr tun als für Freiheit zu werben gegen alle totalitären Ansprüche von Staaten, Partien und Religionen. Zur rechten Balance braucht es rechtsstaatliche Institutionen, die die Bürger vor paternalistischer, sozialistischer oder völkischer Hybris von Demokraten schützen.
Rainer Hank
