Hanks Welt
‹ alle Artikel anzeigen12. Mai 2020
Krieg und Krise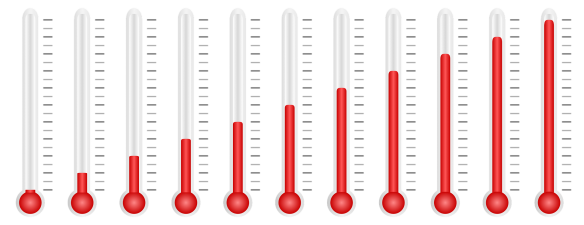
Warum martialische Vergleiche mehr erklären als gedacht
Wir sind im Krieg! Für diesen Satz in der Corona-Krise ist der französische Präsident Emmanuel Macron arg gescholten worden, zumindest hierzulande. Auf den ersten Blick liegt Macron gewiss komplett falsch: Im Krieg gibt es klare Feinde, es gibt am Ende Sieger und Besiegte und schreckliche Zerstörung auf allen Seiten. Es gibt Täter und Opfer, Angreifer und Verteidiger. Das alles wird uns gerade an diesem Wochenende in Erinnerung gebracht, dem 75. Jahrestag der Kapitulation und Befreiung.
Falsch wäre es indessen, den Vergleich der Corona-Krise mit dem Krieg gänzlich ad acta zu legen. Bei näherem Hinsehen gibt es nämlich eine ganze Reihe auffälliger Gemeinsamkeiten. Den Sinn dafür hat uns Harold James geschärft. Der Mann ist Wirtschaftshistoriker, lehrt und forscht an der Universität Princeton und hat vor kurzem in der nicht genug zu lobenden Webinar-Serie seines Princeton-Kollegen Markus Brunnermeier über »Corona-Lektionen« der Kriegs- und Nachkriegszeiten 1918 und 1945 gesprochen. Wie heute wird auch in Kriegszeiten die normale Wirtschaft stillgelegt, nationale Grenzen werden für Menschen, Güter und Dienstleistungen dicht gemacht. Es gibt nur noch ein Thema, dem sich alles andere unterzuordnen hat. Der Staat setzt bürgerliche Freiheiten außer Kraft, gesellschaftliches Leben erstirbt. Dafür nehmen die Staatsschulden in Kriegen ungeheure Ausmaße an, ohne dass es daran nennenswert Kritik gibt. Im Gegenteil: Die Regierungen profitieren im Ansehen bei ihrer Bevölkerung, die Umfragewerte regierenden Partei gehen nach oben. »Rally-round-the-flag« nennt die Politikwissenschaft dieses Phänomen freiwilliger Bürger-Loyalität: In schweren Zeiten versammeln wir uns hinter unseren Führern. Das Parlament akklamiert, die Opposition verstummt.
Keiner weiß, wie lang es dauert
Harold James listet noch eine Reihe weiterer Gemeinsamkeiten auf zwischen Krieg und Pandemie. Besonders überzeugt hat mich die Beobachtung, dass die Menschen nicht wissen, wie lange der Krieg oder die Pandemie dauern, man nicht planen kann und dass genau diese Unsicherheit sich als psychisch zermürbend herausstellt. Durchhalteparolen und Drohszenarien aus Regierungskreisen haben das Ziel, die Menschen bei der Stange zu halten: Angstgetriebene Konformität allerorten. Viel Moral ist im öffentlichen Angebot, achtet man etwa auf die Solidaritäts- und Gemeinwohlrhetorik seit Ausbruch der Corona Krise.
Damit ist der Vergleich noch lange nicht erschöpft. Wirtschafts- und finanzpolitisch geht es darum, wie man nach dem Shutdown wieder in den Zustand der Normalität zurückfindet. Wenn es gut geht, sorgt ein ordentliches Wachstum in der Wiederaufbauzeit dafür, dass die Staaten aus ihren Schulden herauswachsen. Und wenn es gut geht, konsumieren die Menschen dann wieder freudig, anstatt sich in eine Deflation hinein zu sparen, während gleichzeitig eine umsichtige Geld- und Fiskalpolitik dafür sorgt, dass dies am Ende nicht in eine überschießende Inflation fließt. Wenn es schief geht, gibt es einen Schuldenschnitt und das Geld ist weg.
Der Oberbegriff für Krieg und Pandemie heißt Krise. Die FAZ-Dokumentation hat gezählt, dass der Begriff Krise in den führenden deutschen Medien im April 2020 noch häufiger auftaucht als im Krisenmonat des Zusammenbruchs von »Lehman Brothers« im September 2008. Doch was überhaupt ist eine Krise? Auch dafür habe ich eine hilfreiche Hörempfehlung: Petra Gehring, eine an der TU Darmstadt lehrende Philosophin, hat im Jahr 2017 eine Vorlesung gehalten zum Thema »Philosophische Krisendiagnosen im 20. Jahrhundert«, die man im Netz bequem nachhören kann. Gerade weil diese Vorlesung noch keine Kenntnis der Corona-Krise haben konnte, sind die Gedanken der Philosophin hilfreich.
Dabei zeigt sich: Der Begriff der Krise kommt ursprünglich aus der Medizin. Kranke Körper kommen früher oder später in die Krise, jenem Höhepunkt des Krankheitsverlaufs, in welchem sich der Ausgang der Sache entscheidet. Die Krankheit ist ein Prozess, an dessen fiebrigem Höhepunkt völlig in der Schwebe ist, wie alles enden wird: mit Heilung oder Tod. Die Krise selbst bringt die ganze Gesellschaft ins Fieber. Man kann das als Kurve zeichnen mit einem Scheitelpunkt: bezogen auf heute ist das jener Punkt, an dem die Zahl der Infizierten zurückgeht, R kleiner Eins wird – und alle aufatmen. An Corona können wir sozusagen die Urform einer Krise ablesen.
»Alles wird neu!«
Die Fieberkurve mit Scheitelpunkt wurde nicht nur in der Ökonomie das Modell für das Auf und Ab des Konjunkturzyklus, sondern auch in der Militärwissenschaft Vorbild für die Beschreibung von Kriegen als Krisen. Stets bleibt der Krisenbegriff ambivalent. Das zeigt die Floskel von der »Krise als Chance«; die auch heute wieder gerne genommen wird. Es wird dann die Zeit vor der Krise abgewertet (übertriebene Globalisierung, unmenschlicher Kapitalismus, Konsumismus, Egoismus), während das Gute der Krise darin bestünde, die »wahren« Bedürfnisse der Menschen offen zu legen, die Menschen zum »Eigentlichen« zu führen und überhaupt alles zum Besseren zu wenden. Es werde keine Normalität geben »wie vorher«, so tönt es jetzt aus den öffentlich-rechtlichen Fernsehgeräten, eine Drohung, die sich als Verheißung camoufliert.
»Alles wird neu!« heißt der Slogan dieser Krisen-Propheten, als dessen Ahnherrn Petra Gehring den Basler Historiker Jacob Burckhardt anführt. In Burckhardts berühmten »Weltgeschichtlichen Betrachtungen« aus dem Jahr 1905 trägt ein großes Kapitel die Überschrift »Die geschichtlichen Krisen«. Dort findet man nicht nur die Übertragung der medizinischen Terminologie auf Krieg und Frieden, sondern auch genau jene Solidaritätsbeschwörung, die uns heute eingetrichtert wird. Bei Burckhardt wird daraus ungeniert ein Lob des Krieges. Der lange Friede habe eine »eine Menge jämmerliche Existenzen« hervorgebracht: »Sodann hat der Krieg, welcher so viel als Unterordnung alles Lebens und Besitzes unter einen monumentalen Zweck ist, eine enorme sittliche Superiorität über den bloßen gewaltsamen Egoismus des einzelnen: er entwickelt die Kräfte im Dienst eines Allgemeinen, welcher zugleich die höchste heroische Tugend sich entfalten lässt. Er allein gewährt den Menschen den großartigen Anblick der allgemeinen Unterordnung unter ein Allgemeines.«
Würde man die etwas altertümliche Rhetorik des Basler Historikers ein wenig aktualisieren und das Wort Krieg konsequent durch Corona-Pandemie austauschen, dann gehe ich die Wette ein: Man könnte Jakob Burckhardt quasi inkognito unter die vielen Texte von Politikern und Fernsehkommentatoren schmuggeln, die uns heute weismachen wollen, dass die Krise auf wundervolle Weise zeige, wie der Staat in der Lage sei, alle Wirklichkeit einem Gemeinwohlinteresse unterzuordnen. Diese Erfahrung soll nun auch die Grundlage für eine neue solidarische Gesellschaft in der Nach-Corona-Zeit abgeben. Geläutert durch Corona würden wir die jämmerliche Existenz unseres Vorkrisen-Egoismus überwinden.
Sollte es uns nicht zu denken geben, dass die jetzt dem Corona-Ausnahmezustand zugeschriebene kathartisch-heroische Kraft ihren Ursprung hat in der Kriegsverherrlichung des Krisen-Theoretiker des 20. Jahrhunderts?
Rainer Hank
