Hanks Welt
Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).
Aktuelle Einträge
02. Februar 2026Tax the rich
02. Februar 2026Frommer Neoliberalismus
17. Januar 2026Yoga auf Rezept
17. Januar 2026Kanzler-Populismus
16. Januar 2026Larry Summers' tiefer Fall
16. Januar 2026Bohrtürme, Windbeute, Gutmenschen
17. Dezember 2025Mehdorn war's nicht
15. Dezember 2025Folterwerkzeuge
02. Dezember 2025Kriegskinder
02. Dezember 2025Keine neue Hüfte
05. November 2021
Die Macht der Stimmungen und die Stimmungen der Macht
Wie der Zeitgeist Politik und Wirtschaft beeinflusst
Gibt es eigentlich eine Wechselstimmung im Land? Das kommt darauf an, wen man fragt. Es gibt sie, und zwar auf Rekordniveau, behauptet eine Studie der Bertelsmann Stiftung vom August dieses Jahres. Fünfundfünfzig Prozent der Befragten sagten, es wäre gut, wenn die Bundesregierung in Berlin wechseln würde. Lediglich 16 Prozent optierten für den Status quo. Der Rest war unentschieden.
Ganz anderer Meinung ist der Wahlforscher Karl-Rudolf Korte: »Die Deutschen lieben Stabilität«, sagte er noch kurz vor der Wahl zum Bundestag am 29. September. Sie seien risikoavers und favorisierten das Bekannte. Keine Spur also von Wechselstimmung.
Was stimmt? Ich bin kein Wahlforscher, denke aber, beides könnte stimmen. Das wäre dann eine Erklärung für den unerwarteten Aufstieg von Olaf Scholz. »Deutsche Wähler mögen keine jungen Kennedys, keinen charismatischen Überschwang«, sagt Wahlforscher Korte. Solche Eigenschaften kann man Scholz nun wirklich nicht vorwerfen. Er verspricht einerseits Kontinuität, Verlässlichkeit und Respekt: Immerhin war er die vergangenen vier Jahre Finanzminister, ist nicht besonders aufgefallen, hat aber auch nichts wirklich falsch gemacht (sieht man einmal von Cum-Ex und Wirecard ab). Andererseits gibt er sich jetzt als Vertreter des gesellschaftlichen Fortschritts, der mit Grün und Gelb in einer »Koalition der Gewinner« vieles besser machen würde, was die SPD auch schon in den vergangenen drei großen Koalitionen hätte anders machen können. Auf Scholz können sich sowohl die einigen, die Wechsel wollen, als auch jene, die keine Experimente wollen. Er ist der kleinste gemeinsame Nenner des Wahljahres 2021.
Wer wissen will, was wirklich eine Wechselstimmung ist, muss ein ganzes Stück zurückgehen in der Geschichte der Bundesrepublik. Zuletzt gab es so etwas im Jahr 1998, einige werden sich erinnern. Damals dominierte der Wunsch, den CDU-Kanzler Helmut Kohl abzuwählen. Statt Union und FDP wählten die Deutschen zwei Oppositionsparteien – Rot und Grün – in die Regierung. So einen Wechsel hat es nie zuvor und nie danach gegeben. Auch heute bilden zwar FDP und Grüne das eigentliche Machtzentrum der Koalitionssondierungen: Doch fest steht eben auch, dass sie sich mit Schwarz oder Rot einen Anker der vergangenen großen Koalitionen zur Stabilisierung suchen müssen.
Der inhaltlich gravierendste polit-ökonomische Stimmungsumschwung der Nachkriegszeit hat sich indessen zwanzig Jahre vor Kohls Abwahl in Großbritannien ereignet als 1979 Magret Thatcher zur Premierministerin gewählt wurde. Das war zugleich der Abschied von der Idee eines staatsgetriebenen, keynesianisch-interventionistischen Wohlfahrtsstaats, hin zur Überzeugung, dass Märkte eine allen nützende Wachstumsdynamik entfalten würden, wenn man sie nur machen ließe. Angebots- statt Nachfragepolitik. Hayek statt Keynes. Laissez faire statt finetuning. So, grob und ungefähr, lauteten die Parolen damals.Die neoliberale Wende
Die Wahl Thatchers war eine epochale Zäsur, bei der es um die Frage ging, wer die »Kommandohügel« (Lenin) in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft besetzt: Der Markt oder der Staat? Vom Jahr 1979 ging damals ein Signal in die Welt, dem sich weder rechte, noch linke, schon gar nicht liberale Parteien entziehen konnten. Nicht nur Ronald Reagan (1981) oder Helmut Kohl (1982), sondern eben auch Tony Blair (1997) und Gerhard Schröder (1998) zeigten sich davon überzeugt, dass der Wohlfahrtsstaat von seinen Verkrustungen befreit, Güter- und Arbeitsmärkte dereguliert und die Politik mit ihren bürgerbeglückenden Fantasien sich bescheiden müsse. Man nennt das heute die neoliberale Wende. Der Sozialdemokrat Gerhard Schröder war so gesehen zwar personell ein Neuanfang, ideengeschichtlich blieb er ein Enkel Margret Thatchers – was im Übrigen (eine Lieblingsfloskel Schröders) nicht zum Schaden des Landes war, denkt man an die Agenda 2010.
An der neoliberalen Wende des Jahres 1979 zeigt sich die »Macht der Stimmungen«, von der der Soziologe Heinz Bude spricht. Doch was ist eigentlich eine Stimmung, wenn sie so viel Macht hat? Der Begriff stammt ursprünglich aus der Musik, wo es um die Festlegung von Frequenzverhältnissen geht, etwa in Bezug auf einen Referenzton wie den Kammerton »a« mit traditionell 440 Herz. Wenn es glückt, ist die Stimmung gut, wenn nicht, ist sie eher gedämpft. Aus der wohltemperierten Tönung der Musik hat sich der Begriff seit dem 18. Jahrhundert auf die Grundverfassung der Seele und das Verhältnis von Mensch und Welt erweitert. Eine Stimmung eint Menschen, mag die Gesellschaft auch ökonomisch, sozial oder politisch gespalten sein. Insofern übt die Stimmung ein Konformitätsgeschehen aus, das auch problematisch sein kann. Als sich zeigte, dass Armin Laschet hi und da nicht richtig zog, kippte die Stimmung, wie man so sagt – überraschenderweise zugunsten von Olaf Scholz, den vorher keiner auf dem Zettel hatte.
Auch wenn es immer wieder Stimmungsmacher gibt (gar Stimmungskanonen), so bleibt doch verstörend, dass hinter der Macht der Stimmungen kein lenkendes Subjekt steckt. Niemand führt Regie. Die neoliberale Wende hat vorher niemand ausgerufen, sie war plötzlich da, ohne dass man sie gleich so genannt hätte. Ähnlich ging es dann auch mit dem »Ende des Neoliberalismus« (Wolfgang Streeck), das man erst wahrnahm, als es schon hinter einem lag. Stimmungen, gar Wechselstimmungen, kommen zwar nicht aus dem Nichts, aber sie kommen doch irgendwie über uns, vergleichbar einer Euphorie, Nostalgie oder gar Depression.Besser nicht regieren?
Notabene – und damit zurück zur Politik – gibt es immer wieder Ereignisse, welche die herrschende Stimmung konterkarieren. Spektakulär passierte so etwas bei den Jamaika-Verhandlungen nach der Wahl 2017. Damals war die politische Stimmung eindeutig: Nie wieder Große Koalition. Dann gab es wochenlange Sondierungen für eine Jamaika-Koalition, welche die Liberalen am Ende platzen ließen, weil sie der Meinung waren, von Schwarz-Grün über den Tisch gezogen zu werden. »Besser nicht regieren, als schlecht regieren«, dieser Satz Christian Lindners ist seither das Trauma der Liberalen geworden, weil viele Wähler (vor allem viele Wähler, die zum ersten Mal FDP wählten) sich um ihre Stimme betrogen fühlten und den Liberalen vorwarfen, die herrschende Stimmung zu missachten.
Im Nachhinein zeigte sich, dass die Verhandlungen damals gezeichnet waren von Spannungen nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Parteien, bei welchen Egoismen und mit Misstrauen unterlegte interne Machtansprüche das Geschehen dominierten. Keiner traute keinem. Das führte dazu, dass es entgegen der verbreiteten Stimmung am Ende wieder zu einer von allen ungeliebten, großen Koalition kam.
FDP und Grüne haben aus dem Unglück von 2017 vor allem eines gelernt: Wer Stimmungen ignoriert, verliert. Vieles spricht dafür, dass sie dieses Mal die Macht der Stimmungen besser zu nutzen verstehen.
Gerkürzte Fassung meiner Einleitung zur Freiburger Tagungen »Stimmungen« am Walter Eucken Institut 8. Oktober 2021
Rainer Hank
20. Oktober 2021
Anreize zum Impfen
Peitsche schlägt Zuckerbrot
Meine zweite Corona-Impfung habe ich mir von meinem HNO-Arzt spritzen lassen. Vergangene Woche traf ich den Doktor und fragte ihn, wie viele Impfwillige derzeit durchschnittlich in seine Praxis kämen. »Praktisch keiner mehr«, antwortete der Arzt und berichtete von einem Patienten, den er als besonders klug beschrieb, der sich standhaft einer Impfung widersetze und sich zur Rückversicherung seiner Weigerung nächtelang in die Lektüre komplexer Studien vergrabe. Den Einwand des Arztes, angesichts der vielen erfolgreichen Impfungen hätte man wohl von gravierenden Nebenwirkungen gehört haben müssen, schlägt der Impfverweigerer in den Wind: »Die halten das alles unter Verschluss«, entgegnet er, wobei er mit »die« böswillige Regierungskreise meint.
Der Fall lässt Zweifel aufkommen an der Behauptung unseres Chefvirologen Christian Drosten, die Impfbereitschaft sei eine Funktion des Bildungsgrads. Recht hat Drosten zweifellos, wenn er sagt, das Schließen der »Impflücke« sei das A und O der Pandemiebekämpfung. Wer sich impfen lässt, schützt seinen Mitmenschen und sich selbst. Wenn sich gut 80 Prozent der Bevölkerung über 12 Jahre impfen ließen, würden Covid-19 und seine Mutanten ihren Schrecken verlieren. Zu kooperieren ist sowohl altruistisch wie egoistisch gesehen ziemlich rational.
Den Impfgegner meines HNO-Arztes wird man damit nicht erreichen. Er hat sich gegen die Logik der Kooperation immunisiert und bleibt ein kluger Tor. Offenbar führen Informationen nicht zu Verhaltensänderungen. Kein Wunder, dass in vielen Ländern, darunter auch Deutschland, die Impfquote seit geraumer Zeit bei gut 60 Prozent stagniert. Die Erfahrung spricht indes dafür, dass die nicht Geimpften keine unbelehrbaren Hardcore-Widerständler sind. Zumindest die Hälfte der heute noch Ungeimpften könnte für die Spritze gewonnen werden. Doch wie?
Wenn Aufklärungskampagnen nicht zum Erfolg führen, dann bringen Ökonomen gerne das Zauberwort »Anreize« ins Spiel. Anreize sind Signale, die außerhalb einer Person liegen. Sie wirken, indem sie Menschen zu einem bestimmten Verhalten veranlassen. Anreize können zwar keine Wunder bewirken, aber kooperatives Verhalten zum Nutzen aller in die Wege leiten und Trittbrettfahren weniger attraktiv machen.
Man unterscheidet positive von negativen Anreizen. Im Deutschen geht es um Zuckerbrot (wer weiß eigentlich noch, was das ist?) oder Peitsche; im Englischen um »stick or carrot«. Seit sich die Impfzentren leeren, aber immer noch viele ungeimpft sind, wird ausprobiert, ob und wenn ja welche Anreize helfen. Dass die Impfgegner dies als »Impfpflicht durch die Hintertür« abtun, sollte man ihnen nicht durchgehen lassen. Anreize sind keine deterministischen Automatismen. Wer nicht will, braucht sich nicht pieksen zu lassen. Er muss freilich Nachteile in Kauf nehmen oder kann Vorteile nicht nutzen, kann womöglich nicht ins Restaurant, ins Kino oder zur Sonntagsmesse gehen.
Mich interessiert, ob negative oder positive Anreize zielführender sind. Soll man Impfverweigerer bestrafen oder sie belohnen, damit sie sich umentscheiden? Oder sogar beides? Dafür bietet die Corona-Welt derzeit den Verhaltensökonomen frei Haus empirisches Material. Intuitiv würden viele Menschen die Belohnung der Bestrafung vorziehen. Das ist vermutlich eine der Pädagogik früherer Zeiten entstammende Präferenz: Dem Kind ist die Tafel Schokolade allemal lieber als die Tracht Prügel.Dass der Staat zur Belohnung fürs Impfen Geld in die Hand nimmt, ist dann gerechtfertigt, wenn dadurch höhere Pandemiekosten vermieden würden. Simulationen haben allerdings ergeben, dass es schon ziemlich viel Geld sein muss, bevor die Zauderer sich ins Impfzentrum bewegen. Zudem könnten Impfgegner sich bestätigt fühlen: Wenn der Staat eine Prämie aussetzt, wird womöglich an der Sache doch etwas nicht ganz koscher sein. Versuchspersonen in der Pharmaindustrie zahlt man ja auch Geld, um ein unsicheres Medikament an Mann und Frau zu bringen. Und schließlich könnten die freiwillig Geimpften es unfair finden, dass ihr kooperatives Verhalten nicht belohnt wurde, während ganz Clevere darauf spekulieren, die Prämie werde erhöht, wenn sie nur lange zuwarten.
Vor- und Nachteile einer Impflotterie
Eine ganze Reihe dieser Nachteile würde eine Impflotterie vermeiden, für die der Kölner Spieltheoretiker Axel Ockenfels gewisse Sympathien hegt: Alle Bürger nehmen automatisch an der Lotterie teil. Die ausgelosten Gewinner erhalten einen Geldpreis – aber nur dann, wenn sie bereits geimpft sind. Das Design dieser Lotterie macht sich die verhaltensökonomische Einsicht zunutze, dass Menschen Verluste schlimmer finden als Gewinne: Wer sich nicht impfen lässt, dem könnte ein beträchtlicher Geldbetrag entgehen. Ockenfels bezweifelt jedoch, ob mit Lotterien viel zu machen wäre. Daten aus den USA legen nahe, dass der Effekt auf die Impfquote gering und nur von kurzer Dauer ist. Auf Dauer nützt sich »Nudging« (»schubsen«) ab.
Hinzu kommt ein grundsätzlicher Einwand gegenüber Belohnungen, auf den mich der Bonner Verhaltensökonom Matthias Sutter aufmerksam macht: Der Mensch, wie er nun mal so ist, gewöhnt sich an die Belohnungen und nimmt sie irgendwann als selbstverständlich (und verdient) wahr. Damit Belohnung wirkt, muss sie ständig eingesetzt werden (was sehr kostspielig ist) und sie müsste sogar gesteigert werden, um den gleichen Effekt zu behalten, weil sich die Leute daran gewöhnen. Das verbraucht am Ende ganz schön viele Karotten. Wenn wir in der Zukunft in eine Situation kommen, wo wir alle sechs bis neun Monate eine Auffrischungsimpfung brauchen, könnte Belohnung langfristig schlecht wirken und zugleich teuer werden.
Von Bestrafung dagegen versprechen sich die Ökonomen deutlich bessere Verhaltensänderungen. Um den Anschein der harten Peitsche zu mildern, sprechen die Wissenschaftler von »altruistic punishment«, womit die freundliche Abmahnung im Interesse der Allgemeinheit gemeint ist. Der Vorteil der Bestrafung gegenüber der Belohnung besteht darin, dass das Damoklesschwert der Strafe auch schon ohne seine Anwendung eine abschreckende Wirkung entfaltet: »Und bist Du nicht willig!« In den Laborversuchen der Wissenschaftler bestrafen die Versuchspersonen ihre Mitspieler nur sehr, sehr selten, es genügt ihnen, die Option zu haben, das Verhalten durch Strafen in die »richtige« Richtung lenken zu lenken, berichtet Sutter.
Das Ergebnis ist wenig schmeichelhaft für die menschliche Natur: Eine Bestrafung wirkt effizienter als eine Belohnung. Schon ihre Androhung macht gefügig. Wer nicht geimpft ist und deshalb in Quarantäne muss, steht künftig ohne Lohn und Gehalt da. Das ist bislang die teuerste Peitsche, die der Staat schwingt. Zusätzlich könnte man die Tests verteuern oder 2G statt 3G zur Zutrittsschranke im öffentlichen Leben machen. Wenn die Anreiztheorie Recht hat, müsste dann die Impfquote hoch gehen.
Rainer Hank
11. Oktober 2021
Wenn Bayern sich selbständig macht
Ein Gedankenspiel über das Recht der Minderheiten
Nehmen wir einmal an, die Bundestagswahl an diesem Sonntag führte zu einem Ergebnis, das viele inzwischen für nicht unwahrscheinlich halten: Unter der Führung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) kommt es zu einer rot-grün-roten Koalition. Zwar hat Scholz sich eine Weile lang rührend um die FDP bemüht. Doch die Gespräche scheitern am Ende an der Finanzpolitik. Während die Liberalen sich standhaft gegen die Einführung einer Vermögenssteuer, die Anhebung der Einkommensteuer und die Lockerung der Schuldenbremse wehren, läuft der SPD-Mann mit seinen Steuervorschlägen bei den Linken offene Türen ein.
Nehmen wir zusätzlich an – was viele für ebenfalls nicht völlig unwahrscheinlich halten -, die Berliner Initiative zur Enteignung großer Wohnungskonzerne hätte auch Erfolg und ein neuer rot-rot-grüner Senat in der Hauptstadt unter Führung von Franziska Giffey käme gar nicht darum herum, das demokratische Votum der Mehrheit in ein Gesetz zu gießen und die Vergesellschaftung des Immobilienbestandes in Angriff zu nehmen. Anschließend fände das Enteignungsgesetz auch im Kabinett Scholz rasch viele Freunde.
Nehmen wir also an, es käme so auf vollkommen demokratische Weise zu diesem Wahlausgang, dann wäre es nicht übertrieben zu sagen, wir befänden uns danach in einer anderen, nämlich linken Republik, in der das Privateigentum nicht mehr geachtet, die Erfolgreichen konfiskatorisch ausgenommen und – auf Drängen der Grünen – mit Blick auf den Klimawandel stärkere Eingriffe in die Bewegungsfreiheit der Bürger an der Tagesordnung wären.Ich will hier keine »Rote-Socken-Angst« schüren. Mir geht es um eine rechtsphilosophische Frage: Welche Möglichkeit haben Minderheiten, sich gegen den Willen der Mehrheit zur Wehr zu setzen. Die naheliegende Antwort lautet: Gar keine. So ist es eben in einer Demokratie. Die Unterlegenen haben sich der Mehrheit zu beugen. Sie können dafür werben, dass bei der nächsten Wahl wieder ihre Leute an die Macht kommen, die den Sozialismus zurückdrängen. Würden sie zwischenzeitlich sehr ungeduldig, bleibt es ihnen unbenommen, in ein liberaleres Land (zum Beispiel in die Schweiz) auszuwandern. Demokratie, so schrieb Alexis de Tocqueville vor bald zweihundert Jahren, ist eine Art Diktatur der Mehrheit. Da kann man nichts machen.
Renaissance des Sezessionismus
Kann man wirklich nicht? Der Einzelne hat aus guten Gründen wenig Möglichkeiten, ihm nicht behagende Wahlergebnisse zu korrigieren. Doch wie ist es mit größeren Gebietskörperschaften? Nehmen wir in unserem Gedankenexperiment jetzt noch an, anders als die rot-grün-rote Mehrheit im Bund würde es in Bayern unter Führung des charismatisch kraftstrotzenden Heroen Markus Söder zu einer satten Mehrheit der CSU kommen. Das würde den alten Gegensatz zwischen München und Berlin wieder aufleben lassen, nicht zuletzt, weil zu befürchten wäre, dass die rot-grün-roten Steuer- und Klimapläne vor allem die erfolgreichen Unternehmen und Wirtschaftsbürger Bayerns (und Baden-Württemberg, aber das wäre ein anderes Thema) träfen. Kein Wunder, dass in Folge davon alte sezessionistische Ideen im Freistaat eine Renaissance erleben. Einer vor vier Jahren veröffentlichten Umfrage des britischen Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge wünscht sich ein Drittel der Bayern die Unabhängigkeit von der Bundesrepublik Deutschland. Die Bayernpartei hält diesen Autonomiegedanken seit Jahren am Leben.
Wie legitim sind separatistische Auf- und Ausbrüche in Demokratien? Bayern, spätestens seit der Reichsgründung 1871 ein Volk ohne Nation, könnte sich an Katalonien und Schottland ein Beispiel nehmen: Katalonien kämpft seit langem gegen die Dominanz der spanischen Zentrale. Und Schottland, latent separatistisch seit dem »Act of union« mit England im Jahr 1707, träumt neuerdings wieder von einer Abspaltung, nachdem das Vereinigte Königreich sich seinerseits mit dem Brexit aus der Europäischen Union verabschiedet hat. Allemal geht es um die schwierige Balance zwischen Zentrale und Peripherie und ihre ethnisch (darf man das bei Bayern sagen?) oder sozialpsychologisch unterschiedlich tickenden Bevölkerungen. Sagen wir so: In Berlin ist man es gewohnt, vom Rest der Republik alimentiert zu werden. In München (gewiss auch in Stuttgart) hat man gelernt, dass das Geld erst verdient werden muss, bevor man es ausgeben kann. Kein Wunder also, dass der Freistaat aufmuckt und ein freier Staat werden will.
Abspaltungen von Staatsteilen werden hierzulande verunglimpft als nationalistisch-engstirnige Kleinstaaterei. Dass diese Verunglimpfung latent von einem imperialen (wenn nicht imperialistischen) Gedanken zehrt, wird zumeist übersehen. Als ob immer engere Integration – »ever closer union«, wie es in den EU-Verträgen heißt – ein Ziel an sich wäre! Stets gilt es abzuwägen, wie hoch die Integrationskosten im Vergleich zum Nutzen des Großstaates sind. Staatenbünde und Bundesstaaten sind kein Selbstzweck. Ihre Legitimation steht dann infrage, wenn Minderheiten zu viel abverlangt wird.Ein Blick auf Georg Jellinek
Der Gedanke des Minderheitenschutzes in einer Demokratie wurde ausgerechnet in jenem 19. Jahrhundert entwickelt, das als Jahrhundert des kolonialen Imperialismus gilt. Er speist sich aus zwei philosophischen Quellen: Dem Liberalismus, dem das Selbstbestimmungsrecht der Menschen wichtig ist. Und einem Romantizismus, der den organischen Zusammenhalt in einer Gesellschaft betont (ich empfehle einen Ausflug in dass großartige neue Romantik-Museum in Frankfurt am Main). Man gewinnt nichts, hier immer gleich niederen Nationalismus zu wittern. Georg Jellinek, ein Anfang um 1900 in Heidelberg lehrender österreichischer Staatsrechtler, ist der Ansicht, die Demokratie sei eine Gefahr für Minderheiten. Das nimmt der Idee der Solidarität ihre moralische Unschuld. Jellinek schreibt 1898: »Je weiter die Demokratisierung der Gesellschaft vorwärtsschreitet, desto mehr dehnt sich auch die Herrschaft des Majoritätsprinzips aus. Je mehr das Individuum durch den Gedanken der Solidarität zurückgedrängt wird, desto weniger Schranken erkennt der herrschende Wille gegenüber dem Einzelnen an.« Die Anerkennung von Rechten der Minderheiten wirkt als heilsames Korrekturprinzip gegenüber der Übergriffigkeit demokratischer Mehrheiten.
Lassen wir die Kirche im Dorf. Wir halten es nicht für sehr wahrscheinlich (aber eben auch nicht für völlig ausgeschlossen), dass es in Berlin zu rot-grün-rot kommt. Wir halten es noch weniger für wahrscheinlich, dass Bayern in den kommenden vier Jahren die Bundesrepublik verlässt. Doch es kann nicht schaden, an einem Wahlsonntag das liberale Erbe in Erinnerung zu rufen, demzufolge der Bürger stets zwei Möglichkeiten hat, sich in einer Demokratie zu artikulieren: Mit seiner (Wahl)stimme (»voice«) und mit der Handlung, allein oder mit anderen auszuwandern (»exit«). Ohne Minderheitenschutz ist keine gute Demokratie zu machen.
Rainer Hank
20. September 2021
Lauter kleine Kapitalisten
Ein Vorschlag, das Problem teurer Mieten zu lösen
Deutschland ist ein Land der Mieter. Die Wohneigentumsquote stagniert, obwohl Wohneigentum im vergangenen Jahrzehnt erheblich an Attraktivität gewonnen hat. Zwar sind die Preise von Immobilien kräftig gestiegen. Doch auf der anderen Seite hat die Zinsentwicklung die Preisentwicklung vielerorts überkompensiert, wie es in einer neuen Analyse des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) heißt.
Statt zu kaufen, jammern die Deutschen lieber. Statt selbst zu kleinen Kapitalisten zu werden, wollen sie die Groß-Kapitalisten enteignen.
Knapp die Hälfte der Deutschen nennen ein Häuschen oder eine Eigentumswohnung ihr eigen. Die andere Hälfte wohnt zur Miete. In Berlin ist es besonders krass: Dort sind über achtzig Prozent der Menschen Mieter. Nirgendwo in Europa gibt es so wenig Wohneigentümer wie in Deutschland. »Immobilienvermögen ist der Schlüssel zu einer gleichen Vermögensverteilung in Deutschland«, lese ich in einer neuen Studie des »Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung« (DIW). Kein Wunder, dass die Deutschen weniger vermögend sind als Spanier oder Italiener.
Das alles ist merkwürdig. In Befragungen sagen viele junge Deutschen, sie wünschen sich eine eigene Wohnung. Warum sie den Wunsch nicht umsetzen, ist unklar: Komplizierte Genehmigungsverfahren werden genannt, hohe Kosten für Makler, Notare und eine unfaire Grunderwerbsteuer. Ein Haus zu finanzieren ist ein Wagnis – wenn man angesichts der zögerlichen Bautätigkeit denn überhaupt eines findet. Der Staat, der hierzulande für alles und jedes sich zuständig erklärt, fühlt sich für den erleichterten Zugang zu erschwinglichem Wohneigentum nicht wirklich verantwortlich. Lieber wird jetzt wieder viel über Sozialwohnungen geredet – ein Konzept aus der sozialdemokratischen Mottenkiste; da wohnen in der Regel die Falschen, viel zu lange und zu viel zu günstigen Preisen.
Ein Blick nach Singapur
Wenn Wohnen »die neue soziale Frage« ist, wie man derzeit – völlig übertrieben – hört, schlage ich vor, den Blick nach Asien zu richten. Vergangene Woche war ich in Singapur. Das Land öffnet sich, nachdem man sich achtzehn Monate lang fast hermetisch von der Außenwelt abgeschirmt hat, um das Corona-Virus abzuschrecken – was dann doch nicht ganz geklappt hat. Singapur hat die höchste Eigentümerquote auf der ganzen Welt. Sie liegt bei über achtzig Prozent. Das ist die umgekehrte Relation verglichen mit Berlin. In Singapur lässt sich ein gelungenes Sozial-Experiment studieren, wie aus Mietern oder Wohnungslosen Eigentümer werden – und das unter erschwerten Bedingungen. Der Stadtstaat beherbergt auf einer Fläche, die gerade einmal doppelt so groß ist wie Bremen, inzwischen 5,7 Millionen Menschen (in Bremen sind es rund 600 000). In den sechziger Jahren, als der neue Staat gegründet wurde, zählte man lediglich 1,6 Millionen Menschen. Das Land zieht seither wie ein Magnet Menschen aus der ganzen Welt an. Das führte zu einer extremen Wohnungsnot.
Die Regierung parierte die Krise mit drei genialen Maßnahmen. Erstens gelang es, dem Meer in enormem Umfang Land abzugewinnen: damit vergrößerte sich die Fläche des Staates von 580 Quadratkilometern im Jahr 1965 auf 728 Quadratkilometer 2020.
Zweitens erklärte der Staat sich dafür zuständig, in großem Stil serielle Wohnungen zu bauen. »Seriell« muss nicht bedeuten, dass diese Wohnungen so unwirtlich aussehen, wie unsere Trabantenstädte in Neuperlach & Co. In den Häusern aus den sechziger Jahren, die wir uns in Singapur angeschaut haben, gibt es viel »Co-Living-Space« für die Bewohner, eine Idee, die auf der gerade stattfindenden Architektur-Biennale in Venedig als Zukunftsvision gepriesen wird. Singapur achtet auch auf eine gesunde soziale Mischung der Eigentümer, um eine Ghettobildung zu vermeiden.
Drittens schließlich kümmert der Staat sich um die Finanzierung der Wohnungen. Eine Wohnungsgesellschaft – das Housing and Development Board (HDB) – entwickelt die Bauprojekte. Entstanden sind im Lauf der Jahre über eine Million Wohnungen, die der Staat auf 99 Jahre den Bürgern überlässt. Die Appartements werden zu subventionierten Preisen und nach bestimmten Prioritäten an Singapurer Bürger verkauft. Gibt es mehr Anspruchsberechtigte als Wohnungen werden die knappen Eigenheime verlost – ein ökonomisch faires Verfahren.
Auch von der Schweiz lässt sich lernen
Jeder einheimische Bürger sollte Eigentümer werden können, so lautete die Devise des charismatischen Staatsgründers Lee Kuan Lew. Die staatliche Rentenkasse, in die jedermann Monat für Monat vierzig Prozent des Einkommens für Alter und Krankheitsschutz einzahlen muss, gewährt einen Kredit, der bis zu 90 Prozent des Hauspreises finanziert. Im Verlauf des Arbeitslebens muss dieser Kredit vom Eigentümer zurückgezahlt werden. Frühestens nach fünf Jahren können die Wohnungen zu Marktpreisen weiterverkauft werden. Das passiert häufig und ist ein Weg, wie Angehörige der unteren Mittelschicht ziemlich reich werden können. Eine Zweizimmerwohnung etwa, die vom Staat in den sechziger Jahren für 5000 Singapur-Dollar angeboten wurde, ist derzeit für 220 000 Dollar auf dem Markt – eine unschlagbare Rendite. Mit dem Erlös lässt sich trotz überhitztem Immobilienmarkt eine hübsche Wohnung in einem schicken Mehrparteienhaus (Condominium) erwerben.
Wem Singapur zu ostasiatisch klingt, der soll sich in der Schweiz umsehen. Dort haben sogar im Land lebende Nichtschweizer das Recht, aus ihrer kapitalgedeckten Altersvorsorge AHV Geld zur Finanzierung eines selbst genutzten Eigenheims zu entnehmen. Das ist dann eine Art Vorbezug seiner Altersersparnisse.
Man wird das Modell Singapur oder Schweiz nicht jeweils eins zu eins auf Deutschland übertragen können. Wichtig ist mir der Grundgedanke: Wenn der Staat sich um das Wohnen seiner Bürger kümmern will, dann ist es besser, er verhilft ihnen zu Eigentum als zu Mietsozialwohnungen. Dreh- und Angelpunkt ist der Zugang zu Kapital. Weil es in Deutschland keine kapitalgedeckten Pensionsfonds gibt, sondern lediglich die gesetzliche Rente, die als Umlage funktioniert, müssen wir uns hier etwas anderes einfallen lassen. Das IW empfiehlt zinslose oder zinsgünstige Kredite, die über eine Immobilienkreditversicherung abgesichert werden und die etwa im Fall von Arbeitslosigkeit, Scheidung oder dem Tod eines Partners die Weiterzahlung der Raten sicherstellt. Das würde die Scheu vor der hohen Verschuldung reduzieren.
Aus einer eigenen Wohnung kann einen kein Immobilienhai vertreiben. Man hat Vermögen und für das Alter vorgesorgt. Klingt super. Bleibt die Frage, warum die Eigentumsbildung in den Programmen der Parteien unter »ferner liefen« vorkommen. Da kann ich nur spekulieren: Eine lang gepflegte politische Stimmung des Antikapitalismus fürchtet sich vor einem Volk von lauter kleinen Kapitalisten.
Rainer Hank
17. September 2021
Destruktion hat Zukunft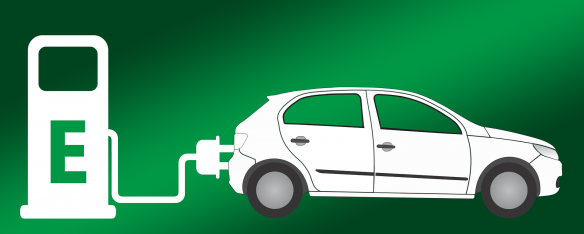
Keine Angst vor der Transformation
So viel Transformation war nie. Wir hören viel von der »digitalen Transformation«, der »großen Transformation«, der »biologischen Transformation« – und natürlich der grundlegenden Transformation unseres Wirtschaftens angesichts der von der Klimakrise bedrohten Welt.
Was versteht man unter Transformation? Eine erste Definition lautet: Transformation bezeichnet das Umwandeln oder Umgestalten von etwas in einen anderen Zustand. Es geht um die Umstrukturierung eines bestehenden Systems in ein anderes. Kaum ein Begriff hat in letzter Zeit eine solche Karriere hingelegt wie die Transformation. Anschaulich zeigt dies die Wortverlaufskurve des digitalen Wörterbuches der deutschen Sprache: Nach dem Jahr 2010 erlebt die seit 1946 flach verlaufenden Linie ein exponentieller Schub, der sie steil, fast vertikal, ansteigen lässt. Sofern Sprache etwas mit der Wirklichkeit zu tun hat, muss man sagen: Irgendetwas passiert. Aber was?
Transformationen sind mit Ängsten verbunden. Veränderungen mögen theoretisch willkommen sei, wird es konkret, fürchten wir sie. Unser Wohlstand – oder der unserer Kinder – ist gefährdet. Unsere Arbeit könnte uns ausgehen. Kein Wunder, dass Industrie und Gewerkschaften an den Staat und die Politik die Forderung herantragen, die Transformation abzufedern und potenzielle Verlierer zu entschädigen.
Machen wir es konkret am Beispiel der Automobilindustrie – passend zur IAA in München. Die Branche befindet sich weltweit in einem der größten Transformationsprozesse seit den Erfindungen von Gottlieb Daimler, Robert Bosch und Henry Ford. Wesentliche Aufgabe der Transformation ist der Umstieg von konventionellen Antrieben der Verbrennungsmotoren auf elektrische Fahrzeuge und Wasserstoffantrieb – und das in atemberaubender Geschwindigkeit. In Deutschland stellen annähernd eine halbe Million Personen Produkte her, die direkt mit der Verbrennertechnik zusammenhängen (Dieselmotoren, Abgasreinigungssystem oder Auspufftöpfe zum Beispiel). Nimmt man die indirekt vom Auto abhängigen Beschäftigten hinzu, sind es 2,75 Millionen Menschen. Rund fünfzig Prozent der europäischen Wertschöpfung im Kraftfahrzeugbau findet in Deutschland statt. Was wird aus diesen Beschäftigten im Transformationsprozess?
Was Linkedin so alles verrät
Das Ifo-Institut in München hat dazu gerade eine aufregende Studie veröffentlicht – nicht nur wegen ihres Ergebnisses, sondern, wie ich finde, auch wegen der dort angewandten Methode. Die Ausgangsfrage war, welche Kompetenzen bei der Fertigung von Autos künftig gebraucht werden. Und ob die heute schon in der Branche Beschäftigten diese Kompetenzen sich aneignen werden oder ob dazu Personal von außen gesucht werden muss. Es braucht im Zeitalter der Elektromobilität nämlich nicht nur neue Berufe, sondern es ändern sich auch die Berufe selbst, das heißt die ausgeübten Tätigkeiten und geförderten Kompetenzen. So bleibt beispielsweise die Berufsbezeichnung Entwicklungsingenieur bestehen. Doch der muss sich jetzt mit Batteriesteuerungen auskennen.
Um herauszufinden, wie gut oder schlecht die deutsche Industrie für die Transformation gerüstet ist, haben sich die Ifo-Forscher der Daten des beruflichen Netzwerkes LinkedIn bedient. Das ist ziemlich pfiffig. Wer bei LinkedIn Mitglied ist, gibt in der Regel mehr oder weniger detailliert ein berufliches Profil von sich und von seinen professionellen Kompetenzen preis. Damit, so das Ifo-Institut, sei es möglich, die Veränderung der Kompetenzen in der deutschen und internationalen Automobilindustrie sehr zeitnah zu analysieren, besser als mit der nachhinkenden amtlichen Statistik der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Allerdings scheinen die Forscher davon auszugehen, dass die LinkedIn-Community ehrlich ist. Sie unterschlagen dabei die menschliche Neigung, die eigenen Kompetenzen in ein besonders gutes Licht zu stellen. Sei’s drum.
»Emerging Jobs« nennen die Forscher Jobs, die das größte Wachstum innerhalb einer Branche oder Region erwarten lassen. Hier liefern die Daten von LinkedIn erfreuliche Resultate: Sowohl in Deutschland wie auch global ist in letzter Zeit vor allem die Zahl solcher Jobs gewachsen, die mit der Digitalisierung in Verbindung stehen (Software und Entwicklung, Daten und deren Analyse). In Deutschland haben diese Jobs sogar überdurchschnittlich zugenommen. Hier gibt es auch besonders viele neue Tätigkeiten im Bereich von Verwaltung und Personal, klingt langweilig, ist aber für Transformationsprozesse unabdingbar. Allerdings wird schnell deutlich, dass die meisten dieser »Emerging Jobs« von Beschäftigten ausgeübt werden, die neu in der Branche sind. Im Vergleich zu den langjährig in der Autoindustrie Beschäftigten bringen die neu in die Branche gewechselten Menschen 71 Prozent häufiger digitale Kompetenzen mit.Sofern man den Zwischenstand der Ifo-Forscher generalisieren darf, ist die Botschaft einigermaßen beruhigend: Es gibt keinen Grund für Apokalyptik. Die Transformation hierzulande ist in vollem Gang. Und auf gutem Weg. Gewinner sind die neu in die Branche kommenden Beschäftigten. Verlierer sind die Altgedienten, denen die Umstellung schwerfällt. Trägheit war immer schon ein Hindernis der Innovation; dem Strukturwandel sind Neulinge besser gewachsen.
Ein Blick auf Karl Polanyi
Der Befund könnte die bisherigen Erfahrungen mit disruptiven Transformationsprozessen in der Wirtschaftsgeschichte bestätigen. Als »große Transformation« bezeichnet man seit den Arbeiten des Wirtschaftshistorikers und Sozialforschers Karl Polanyi (1886 bis 1946) die Verselbständigung und Entfesselung der Marktprozesse zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Polanyi bewertet diese Erfahrung der »Entbettung« von Wirtschaft und Gesellschaft negativ. Das frrühe 19. Jahrhundert markiert zugleich aber den Beginn der industriellen Revolution, die den ehemals armen Bevölkerungsschichten Wohlstand gebracht hat. Das unterschlägt Polanyi.
Hinzu kommt: Regelmäßig sind wirtschaftliche Transformationsprozesse verbunden mit der Angst vor hoher Arbeitslosigkeit. Doch noch nie sind diese Befürchtungen eingetreten. Prozesse der Automatisierung und Roboterisierung politisch verzögern zu wollen (etwa durch eine Maschinensteuer), rettet keine Arbeit, sondern zerstört sie, wie man beim Ökonomen Philippe Aghion nachlesen kann, dessen neues Buch über die »Kreative Zerstörung« ich nicht genug preisen kann. Technische Revolutionen entfalten ihre Wachstumseffekte stets mit einer Zeitverzögerung: So war es bei der Elektrizität, die von Thomas Edison und Werner von Siemens schon Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde – und ihr enormes Potential erst nach der Jahrhundertwende 1900 ausspielte. Ähnlich könnte es jetzt auch mit der Computerisierung und Digitalisierung vor sich gehen. Niemand muss sich vor technologischen Revolutionen und den wirtschaftlichen Transformationen fürchten, lese ich bei Aghion. Eine beruhigende Botschaft.
Rainer Hank
