Hanks Welt
Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).
Aktuelle Einträge
17. Dezember 2025Mehdorn war's nicht
15. Dezember 2025Folterwerkzeuge
02. Dezember 2025Kriegskinder
02. Dezember 2025Keine neue Hüfte
02. Dezember 2025Hongkong als Vorbild
26. November 2025Überraschend robust
26. November 2025Zugang ist alles
21. November 2025Das letzte Stück Kuchen
21. November 2025Rentner streicheln
19. Oktober 2025Wird KI zur Blase?
12. Mai 2023
Die neue Ostalgie
Gibt es ein richtiges Leben im Unrechtsstaat?
In meiner Familie wird die Geschichte eines Vetters erzählt, der eines Nachmittags, es muss Ende der fünfziger Jahre gewesen sein, aus dem Gasthaus zurückkommt und seinem Vater – meinem Onkel – den Satz entgegenschleudert: »Du bist ein Nazi.« Die Antwort ließ nicht auf sich warten: Der Junge bekam eine gescheuert, die derart saß, dass er den Vater nie mehr auf das Thema ansprach.
Katja Hoyer, Mitte der 80er Jahre in der DDR geboren, frug eines Tages ihren Politik- und Geschichtslehrer im wiedervereinigten Jena, wie er heute das Gegenteil dessen lehren könne, was er vor dem Mauerfall unterrichtet habe. Die Antwort ließ nicht auf sich warten: Der Lehrer schmiss Katja aus seiner Klasse.
Von dem Philosophen Hermann Lübbe stammt das Diktum des »kommunikativen Beschweigens«. Nach 1945 hatte man sich im Nachkriegsdeutschland darauf geeinigt, die Jahre zwischen 1933 und 1945 nicht zu thematisieren. Lübbe sprach von »Beschweigen«, nicht von »Verdrängen«, notwendige Vorbedingung für den Neuanfang. Die beiden Beispiele könnte man in Abwandlung des Lübbe-Diktums »aggressives Beschweigen« nennen.
Ein sonderbares, verschwundenes Land
Es kann Jahre dauern, bis aus Beschweigen Verstehen wird. In Westdeutschland hat es bis in die frühen 80er Jahre gedauert, also fast dreißig Jahre, bis ein offenes Gespräch über die Nazizeit möglich wurde. Seit dem Zusammenbruch der DDR sind inzwischen gut 30 Jahre vergangenen. Erst jetzt gibt es in meinem Freundeskreis einigermaßen offen-selbstbewusste Gespräche über biografische Erfahrungen in der DDR, jenem »sonderbaren, verschwundenen Land« (Katja Hoyer). So wundert es nicht, dass sich jetzt Bücher häufen, die antreten, der DDR Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, ohne gleich apologetisch zu werden: »Lütten Klein«, das Buch des Soziologen Steffen Mau beschreibt die Demütigungen, denen die Ostdeutschen in den Jahren der Transformation nach 1989 ausgesetzt waren. »Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung«, der Bestseller des Literaturwissenschaftlers Dirk Oschmann, behauptet wortgewaltig, der Westen brauche den Osten als negative Projektionsfläche, um sich selbst in ein besseres Licht zu setzen.
In diesen Kreis gehört auch Katja Hoyers in diesen Tagen erschienenes, spannend zu lesendes Buch »Diesseits der Mauer«. Die DDR war kein graues Land voller hoffnungsloser Existenzen, so die These. Das andere Deutschland sei mehr als Mauer und Stasi. Auch Hoyer behauptet, die Geschichtsschreibung der DDR werde bis heute vom westlichen Blick dominiert. Mit dem Fokus auf die Verfehlungen der Diktatur werde übersehen, dass die meisten der 16 Millionen Einwohner der DDR ein relativ friedliches und normales Leben mit alltäglichen Problemen, Freuden und Sorgen führten. Die Mauer habe die Freiheit eingeschränkt, aber andere gesellschaftliche Schranken seien gefallen.Katja Hoyer schildert vierzig Jahre deutschen Sozialismus aus der Sicht derer, die ihn selbst erlebt haben. Als »Westdeutscher« bin ich überrascht und beschämt, wie wenig ich weiß. Wir begegnen dem Kommunisten Erwin Jöris 1937 in einer schmutzigen Zelle in Swerdlowsk/Sibierien, wir begegnen Regina Faustmann, die 1951 die Ärmel aufkrempelt, um sich am Wiederaufbau der Wirtschaft zu beteiligen (»Bau auf, bau auf, Freie Deutsche Jugend, bau auf!) oder Andreas Weihe, einem 1980 »durch freiwilligen Zwang« bei der NVA gelandeten jungen Wehrpflichtigen, der verzweifelt hofft, nicht schießen zu müssen.
Die Haltung, die sich in all diesen Erinnerungsbüchern trotzig breit macht, heißt: Innensicht. Deshalb der Titel »Diesseits der Mauer« (Original: »Beyond the Wall«). Es fällt auf, dass all die genannten Autoren die DDR als junge Leute erlebt haben und die Entwürdigung und Depravierung ihrer Eltern oder Verwandten mitansehen mussten, denen sie jetzt Gerechtigkeit verschaffen wollen. Katja Hoyers Vater hatte eine vielversprechende Karriere als Luftwaffenoffizier vor sich, Hoffnungen, die von heute auf morgen vereitelt wurden, wie sie in einem Interview erzählt. Es ist aber auch interessant, dass alle Autoren im demokratischen Kapitalismus Karriere gemacht haben, was kaum möglich wäre, hätte die DDR weiter existiert. Katja Hoyer lebt seit über zehn Jahren in England, forscht als Historikerin am King’s College in London, ist Fellow der Royal History Society und hat eine Kolumne in der Washington Post.
Freiheit lässt sich nicht aufteilen
Wir lassen nicht zu, die Geschichte der DDR pauschal als eine Fußnote der deutschen Geschichte abzutun, die man am besten vergisst, so Katja Hoyer. Das hat freilich seinen Preis. Zu Recht sagt Katja Hoyer, BDR und DDR seien wie ein sozialwissenschaftliches Experiment, bei dem zwei Laborgruppen historisch unterschiedliche Wege gegangen sind. Ökonomisch ist der Ausgang des Feldversuchs eindeutig. Das Bruttosozialprodukt der BRD lag 1949 bei 261 Milliarden Euro, das der DDR bei 37 Milliarden. Am Ende, 1989, war der Wohlstand der Westdeutschen auf 1,4 Billionen Euro angewachsen im Vergleich zu 207 Milliarden der DDR. Katja Hoyer leugnet dies nicht. Aber sie stellt die soziale Gleichheit der DDR der westlichen Marktwirtschaft als mindestens ebenbürtig gegenüber: Eine viel größere soziale Durchlässigkeit, eine Gender-Gerechtigkeit (1988 arbeiten 90 Prozent der Frauen) nebst der staatlichen Förderung von Volks- und Spitzensport, dies Sachen nennt sie als Stärken des Ostens; sozialistischer Alltag im Zustand existenzieller Sorglosigkeit.
Spätestens hier sind Rückfragen nötig. Was heißt soziale Mobilität im Arbeiter- und Bauernstaat, wenn Akademikerkindern das Studium verwehrt wird und Christen das Nachsehen haben, wenn sie nicht in der FDJ waren? Wo steckt der Denkfehler in der »Vision einer klassenlosen Gesellschaft, in der man am oberen Ende des wirtschaftlichen Spektrums freiwillig auf Luxus verzichtete, um am unteren Rand große Armut zu verhindern«? Was heißt Gendergerechtigkeit, wenn Kinder – natürlich nicht alle – in sogenannten Wochenkrippen untergebracht wurden, wo sie bleibenden psychischen und sozialen Schaden nahmen? Und was ist einer egalitären Gesellschaft wert, die nicht auf freier Wahl der Menschen beruht, sondern autoritär und undemokratisch von einer Elite oktroyiert wurde. Die Freiheit ist nicht einfach eine Schranke von vielen, die ein Staat verweigern oder gewähren kann: Ohne Freiheit ist alles andere nichts.
Die Siegerpose der Westler, die den »Beitritt« der fünf neuen Bundesländer 1990 als »alternativlos« durchgezogen haben, hat die Würde der Menschen aus der DDR beschädigt. Diese »Schuld«, die mehr ist als Unsensibilität, wird nicht dadurch ausgeglichen, dass nun die DDR in Nachhinein als das bessere Sozialmodell idealisiert wird. Auch im falschen Leben ist normales Leben in Würde möglich. Doch Unrechtsstaat bleibt Unrechtsstaat.
Rainer Hank
05. Mai 2023
Rock your Life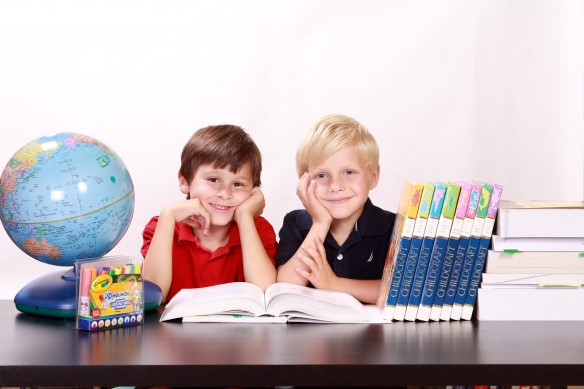
Wie sich Chancengleichheit verbessern lässt
Der »Zufall der Geburt« ist das Ungerechteste, was einem im Leben zustoßen kann. Seine Eltern kann sich bekanntlich keiner aussuchen. In welchem Land ich geboren wurde, in welcher Zeit, in welcher Schicht, in welchen familiären Verhältnissen – nichts davon hängt von mir ab. Fast könnte man meinen, der Zufall der Geburt sei noch unberechenbarer als der des Todes. Zwar kennt auch niemand den Zeitpunkt seines Todes: Albert Camus nannte den tödlichen Autounfall das Absurdeste, was einem im Leben stoßen könnte, und kam selbst im Alter von nur 46 Jahren bei einem Autounfall ums Leben. Ob ich mich allerdings gesund ernähre, mich bewege, geistig rege bleibe, auf all das kann ich Einfluss nehmen, was wiederum Einfluss hat auf die Chance eines langen Lebens. Demgegenüber ist die Geburt pures Schicksal – jenseits jeglicher Einflussmöglichkeiten dessen, der gerade auf die Welt kommt.
Wären die Startchancen für alle gleich, wäre das kein Problem. Jeder wäre frei, das Beste aus seinem Leben zu machen. Doch so ist es bekanntlich nicht. Lebenschancen und Lebenserfolg hängen in hohem Maße von zufälligen Faktoren ab. Etwa dem Einkommen der Eltern, ihrem Bildungsgrad, ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft und der Frage, wie intakt die Familie ist. Ludger Wößmann, einer der führenden Bildungsökonomen in Deutschland, hat dazu gerade schockierende Forschungsergebnisse präsentiert. So liegt die Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen, bei 21,5 Prozent, wenn ein Kind mit einem alleinerziehenden Elternteil ohne Abitur aus dem untersten Einkommensviertel (unter 2600 Euro) und mit Migrationshintergrund aufwächst. Im Gegensatz dazu liegt diese Wahrscheinlichkeit bei 80,3 Prozent, wenn das Kind mit zwei Elternteilen mit Abitur aus dem obersten Einkommensviertel und ohne Migrationshintergrund aufwächst.
Nicht jeder muss aufs Gymnasium
Ich höre die Einwände: Muss doch nicht jeder und jede auf das Gymnasium! Man kann auch glücklich und reich werden ohne höhere Schul- oder Universitätsbildung! Besser ein erfolgreicher Handwerker als ein verarmter Soziologe! Das ist natürlich alles richtig. Doch darum geht es nicht. Zutiefst ungerecht ist, dass der Besuch des Gymnasiums leider nicht Ergebnis freier Wahl ist, sondern abhängt vom sozialen und familiären Umfeld. Es ist dann zumindest statistisch »vorbestimmt«, ob ein Kind eine höhere Schule besuchen wird oder nicht. Interessanterweise ist der Bildungsstand der Eltern wichtiger als die Frage, ob es einen Migrationshintergrund gibt. Das ärmste Migrantenkind mit zwei Abiturienten als Eltern hat bessere Chancen (47,2 Prozent) als ein Kind reicher Eltern (über 5500 Euro) ohne Abi (39,7 Prozent). Das zumindest ist ein positives Resultat für die Frage der Integrations- und Assimilationsfähigkeit einer Gesellschaft und die Chancen auf Bildungsaufstieg für Einwanderer.
Bildung ist der Grundstein dafür, dass Menschen erfolgreich am Arbeitsmarkt und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und zum Gemeinwohl beitragen können. Und Bildung bringt ein höheres Einkommen: Nichtakademiker erzielen ein durchschnittliches Lebenseinkommen von 1,8 Millionen Euro. Akademiker mit Master-Abschluss kommen auf 2,9 Millionen Euro, erhalten mithin einen Bildungszuschlag von 1,1 Millionen Euro. Soziale Durchlässigkeit und die Chance auf sozialen Aufstieg unabhängig vom Herkommen sind wichtig für die breite Akzeptanz einer Gesellschaftsordnung. Auch ökonomisch ist es nicht sehr effizient, wenn das Begabungspotential von Bürgern sich nicht entfalten kann: Das entzieht der Gesellschaft nicht nur Wachstum, sondern auch Kreativität und Dynamik.
Was tun, wenn man nicht einfach jammern will über die Schlechtigkeit und Ungerechtigkeit der Welt? Mehr Geld für Bildung ist die Standardantwort von Bildungspolitikern. Weil Politikern eben immer nur »mehr Geld« einfällt, wenn ihnen nichts einfällt, sie aber den Wahlbürgern ihre eigene Bedeutsamkeit beweisen wollen. Dagegen skeptisch machen sollte einen allein schon die Tatsache, dass die öffentlichen Ausgaben für Bildung seit Jahren kontinuierlich steigen: Im Jahr 2020 haben Bund und Ländern insgesamt 241 Millionen Euro für allgemein- und berufsbildende Schulen ausgeben, eine Steigerung um 40 Prozent. Doch die Ungleichheit der Bildungschancen hält sich seit Jahrzehnten hartnäckig.
Ein überzeugendes Mentoring-Projekt
Es liegt nahe, nach Alternativen zu suchen, die nichts oder wenig kosten, dafür aber mehr taugen. Das Mentoring-Projekt »Rock Your Life« wäre so eine Alternative. Es wurde im Jahr 2008 von drei engagierten Studenten in Friedrichshafen am Bodensee gegründet. Jugendliche aus benachteiligten Familien in problematischen Stadtvierteln sollten ganz praktisch unterstützt werden. Jedem Schüler wird ein Student als Mentor an die Seite gestellt. Die Mentoren machen das unentgeltlich. Den Kern des Projekts bilden individuelle Treffen der Mentoren mit ihren jeweiligen Mentees in einem rund zweiwöchigen Rhythmus. Allein dass sich die Studenten Zeit für sie nehmen, stärkt das Selbstwertgefühl der Jugendlichen. Oft treffen sich die Mentoring-Paare einfach zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten, gehen ins Kino oder in den Zoo, sprechen über den Alltag und die Zukunft.
Der Clou von »Rock Your Life« besteht meines Erachtens darin, dass das Projekt schulischen Erfolg verbessern will durch Aktivitäten außerhalb der Schule. Lehrer denken erwartbar immer nur an Schule, wenn sie Schülern helfen wollen. Dass das Leben nach und vor der Schule dafür womöglich wichtiger ist, ist eine naheliegende, gleichwohl relativ neue Einsicht, die sich nicht zuletzt während Corona zeigte: Schulische Leistungen wurden schlechter, weil der Lockdown das außerschulische Leben zum Erliegen brachte.Die Bildungsökonomen haben »Rock Your Life« methodisch anspruchsvoll (und mit Kontrollgruppen ohne Mentoren) evaluiert. Und siehe da: Das Projekt liefert tolle Ergebnisse. Bei den Jugendlichen aus stark benachteiligten Familien sind die Ergebnisse besonders ermutigend. So haben sich die Schulnoten in Mathe durch die Teilnahme am Mentoring im Durchschnitt um 0,4 Notenpunkte verbessert. Zudem steigt das Maß der Geduld dieser Jugendlichen. Geduld ist deshalb sehr wichtig, weil sie Zukunftsorientierung der Menschen misst anhand ihrer Bereitschaft, Belohnungen auf die Zukunft zu verschieben, Eigenschaften, die für den zukünftigen Erfolg und die Einkommenserwartung entscheidend sind.
Ich finde dieses Rock-Your-Life-Projekt wirklich faszinierend. Im Übrigen wurde aus der spontanen Initiative dieser Studenten ein Startup, das sich inzwischen zu einem veritablen internationalen Sozialkonzern gemausert hat. Es ist in über 50 europäischen Städten als Franchise-Unternehmen aktiv; zehntausend Studenten haben sich daran beteiligt. Anschauen kann man sich das alles hier.
Rainer Hank
03. Mai 2023
Angepasst und defensiv
Warum sind die Liberalen so mutlos geworden?
»Ich sehe aus, wie das lebendige FDP-Klischee«, sagt Johannes Vogel. Der Mann ist stellvertretender FDP-Vorsitzender, trägt dunkelblauen Anzug, weißes Hemd, hellbraune Schuhe – und schämt sich. So jedenfalls erzählt es die Kollegin Helene Bubrowski. Ein anderer liberaler Jungspunt legt großen Wert darauf, sich vom »klassischen Jungliberalen-Klischee« abzugrenzen: »Polo-Shirts mit hochgestelltem Kragen sind nicht meins«, sagte er: Anzüge trage er ungern.
Du meine Güte. Wer trägt denn überhaupt noch Anzüge in einer Welt, in der längst auch die Daimler- und Allianz-Chefs die Krawatte scheuen wie der Teufel das Weihwasser und vor großem Publikum lieber in Jeans und Sneaker posieren? Seit Erich Mende und Guido Westerwelle habe ich schon lange keinen FDP-Mann mehr gesehen, der so aussieht, wie die jungen Herren sich den FDP-Mann vorstellen, mit dem sie keinesfalls verwechselt werden wollen. Lieber biedern sie sich dem uniformen Zeitgeschmack an und dünken sich dabei auch noch individualistisch. Wolfgang Kubicki sieht dagegen vergleichsweise cool aus.
Dies wird hier keine Mode-Kolumne, sondern eine über den Liberalismus und die Liberalen, die fürchten, für Liberale gehalten zu werden. Kapitalismus, neoklassische Ökonomie, solche Sachen gelten als kalt, aber eben nicht als cool. Deshalb wollen die Liberalen jetzt »mitfühlend« und »human« werden. Nach der Kleidung kommt die Sprache dran. Kristalina Georgieva, die Präsidentin des als Hauptsitz der eiskalten Austeritätsideologie geltenden Internationalen Währungsfonds (IWF), hat mit der Sprachreinigung begonnen. Jüngst sprach sie von der aktuellen »Krise der Lebenshaltungskosten« Was meinte sie damit? Früher, in den Zeiten der kalten Ökonomie, wurde dasselbe Phänomen »Inflation« genannt. Aber das schien den IWF-Redenschreibern offenbar zu technisch und unpersönlich. »Krise der Lebenshaltungskosten« bringt die Betroffenen in den Blick, die als Konsumenten zu Opfern steigender Preise werden. Will sagen: Auch der IWF zeigt Gefühle. Dass die Profiteure der Inflation, von denen es viele gibt (Konzerne, Schuldner) damit sprachlich verschwinden, nimmt der neue ökonomische Menschlichkeitsdiskurs bewusst oder unbewusst in Kauf. Der ökonomische Begriff ist komplexer, aber eben leider nicht empathisch und nicht eingebettet in die Lebenswelt der Menschen.
Liberale als Liberalismuskritiker
Dass Kritiker von links über grün bis neo-konservativ seit Jahren den »Neo«liberalismus für alles Schlechte in der Welt verantwortlich machen, ist deren gutes Recht. Dass die Liberalen, scheu und opportunistisch wie sie sind, dem nichts Rechtes entgegenzusetzen wussten, ist traurig. Doch neuerdings singen die Liberalen selbst das Lied der Liberalismus-Kritik fast lauter als diese. Elif Özmen, Philosophie-Professorin aus Gießen, deren verdienstvolle Monografie »Was ist Liberalismus« im Juli im Suhrkamp-Verlag erscheint, verwendet in einem Trailer zu ihrem Buch in der Zeitschrift »liberal« viel Mühe darauf, sich von den »Apologeten des Liberalismus« abzugrenzen. Diese nämlich, also die Verteidiger des Liberalismus, würden häufig im Namen der Freiheit vulgär agitieren für die Minimalisierung der Staatlichkeit, die Entfesselung der Märkte, den Verzicht auf Gemeinwohlorientierung und das Recht, sich jeden Erfolg als Verdienst, jeden Misserfolg als persönliches Versagen zuschreiben zu lassen. Ich vermute, die Autorin merkt gar nicht, dass sie hier in Nuce die gängige Kritik am Liberalismus sich zu eigen macht, distanziert präsentiert durch Begriffe wie »vulgär«, »agitieren«, oder »schlicht«, die es erlauben, einen guten vom ordinären Liberalismus abzugrenzen. Letzteren, wen wunderts, verorte die Akademikerin, bei Journalisten und sozialen Medien. Der Aufgabe, das liberale Projekt gegen seine Kritiker zu verteidigen, widersetzt die Philosophin sich explizit. Das wäre ihr vermutlich zu bekenntnishaft, zu unwissenschaftlich.
Kein Wunder, dass der Liberalismus weltweit in der Defensive ist, Autokraten und Diktatoren immer mehr Zulauf haben. Victor Orban benutzt den Begriff der »illiberalen Demokratie« ja gerade nicht als Schimpfwort, sondern mit stolzem Selbstbewusstsein. »Liberal« heißt für ihn kalt, dekadent, ohne Werte und ohne Haltung, libertär, kapitalistisch und promiskuitiv. Illiberale wären dagegen volksnah und wertegebunden.
Anstatt den illiberalen Populismus mannhaft zu zertrümmern, heißt die Antwort der Liberalen »Mea Culpa« wie im katholischen Beichtstuhl. Timothy Garton Ash, ein großer Liberaler, geißelt in seinem neuen biografischen Buch »Homelands« die Hybris des Westens und des globalisierten Finanzkapitalismus, welche uns große Rezession und soziale Ungleichheit beschert hätten. Das Jahr der globalen Finanzkrise 2008 markiert für Garton Ash die entscheidende Zäsur, in welchem die Utopie einer liberalen und offenen Weltgesellschaft zerstört worden sei und der Liberalismus seine Glaubwürdigkeit verloren habe. Will sagen: Wir sind selbst schuld am Aufstieg des Illiberalismus, verstehen und bedauern das.
Mehr Mut und Offensive wäre nötig
Nun kann man gewiss kritisieren, dass in den Jahren vor 2008 fundamentale ordnungspolitische Grundsätze, etwa das Haftungsprinzip, verletzt wurden. Doch die Verteidiger des Liberalismus müssten zugleich stark machen, in welchem Maße der globale Kapitalismus des späten 20. Jahrhunderts die Jahrhunderte alten Ungleichheiten zwischen den Völkern zu schleifen vermochte, was Millionen Menschen aus der Armut befreit hat. Stattdessen macht auch Martin Wolf, liberaler Chefideologie der »Financial Times«, in seinem jüngsten Buch über die »Krise des demokratischen Kapitalismus« den Zusammenbruch des Finanzsystems 2008 für die Legitimationskrise der westlichen Welt und die Verarmung der stolz arbeitenden Mittelschichten verantwortlich. Dieses Desaster treibe die Menschen in die Arme populistischer Verführer, kein Wunder.
Die Kritik hat sich so langsam herumgesprochen. Selbstbewusste Freunde der Freiheit sollten besser die Stärken des Kapitalismus herausstreichen: Hat sich die Weltwirtschaft (allen voran Deutschland) nicht erstaunlich robust und resilient von der Finanzkrise erholt? Wie kommt es, dass der US-Kapitalismus bis heute weltweit der entscheidende Treiber von Wohlstand, Produktivität und Innovation ist? Eine Demokratie, die das Bündnis mit dem Kapitalismus aufkündigt, verspielt Freiheit und Wohlstand. Dem Einsatz für das historisch überlegene, derzeit höchst gefährdete Bündnis zwischen liberaler Demokratie (inklusive radikaler Meinungsfreiheit) und globalem Kapitalismus müssten alle Anstrengungen der Liberalen gelten. Die Kritik am Liberalismus sollten sie ernst nehmen, die Feinarbeit getrost den Linken, Grünen und Konservativen überlassen. Das können die besser.
Rainer Hank
03. Mai 2023
Last Generation
Warum kommen immer weniger Kinder auf die Welt?
Am Osterfest hat die Financial Times (FT) mich mit einer Headline auf Seite Eins geschockt: »Italiens Geburtenrate auf dem niedrigsten Stand seit 1861.« Zur Zeit der nationalen Einigung Italiens gab es jährlich 800.000 Neugeborene bei 26 Millionen Einwohnern. Heute zählt Italien 60 Millionen Bürger bei nicht einmal 400.000 Babys. Noch nie war Italien weniger fruchtbar als im vergangenen Jahr.
Natürlich ist mir – Kind der babyboomenden Italientouristen – nicht entgangen, dass die Vorstellung des mediterranen Matriarchats mit Mama, Nonna und vielen Bambini immer schon ein Klischee war. Doch die Daten wusste ich nicht: Eine italienische Frau bringt statistisch nur noch 1,24 Kinder auf die Welt. Die natürliche Reproduktionsrate liegt bei 2,1. Schon befürchtet die New York Times, die Italiener könnten, wenn sie nicht aufpassen, bald ganz verschwinden. Dass die Bevölkerung nicht noch schneller schrumpft, liegt daran, dass auch in Italien die Menschen immer gesünder und langlebiger sind und sich die Zahl der Hundertjährigen innerhalb von zwanzig Jahren verdreifacht hat.
Italien ist krass, bestätigt aber einen globalen Trend. Inzwischen gibt es weltweit mehr Menschen über 65 Jahren als unter fünf Jahren. Selbst die Demographie-Fachleute sind überrascht, dass es derart fix geht: Mehr als die Hälfte der Länder in der Welt haben inzwischen Reproduktionsraten unterhalb jener Zahl, die nötig wäre, die Menschheit zu retten. Weil die Entwicklung derart universal ist, greifen auch kulturelle und religiöse Erklärungen allenfalls in Einzelfällen. Dass Israel mit einer Reproduktionsrate von 2,9 die Liste der reichen OECD-Länder anführt und eine Frau dort meint, sie müsse sich entschuldigen, wenn sie weniger als drei Kinder hat, mag Gründe im Glauben an einen Zusammenhang von Fruchtbarkeit und Gottgefälligkeit haben. Dass am Ende der Tabelle Süd-Korea mit nur noch 0,8 Geburten steht (1970 war man noch bei 4,5), lässt sich ebenfalls kulturell erklären, wie mir meine Kollegin Lena Schipper erklärt, die in Seoul lebt: Emanzipierte Frauen weigern sich zu heiraten und Kinder zu kriegen, weil sie dann wieder im archaischen Patriarchat landen würden.
Deutschland sieht nur auf den ersten Blick wie eine kleine Ausnahme aus. Mit 1,53 sind wir wieder auf dem Stand von 1970; zwischendrin war die Geburtenrate in den neunziger Jahren auf 1,3 zurückgegangen. Das führen die Fachleute auf den sogenannten Timing-Effekt zurück, der darin besteht, dass das erste Kind immer später kommt und sich statistisch bei knapp 31 Jahren eingependelt hat. Auch der Wende-Schock mag eine Rolle spielen, der dazu führte, dass die Rate in den neuen Bundesländer schon mal unter 1 lag. Inzwischen hat sich Deutschland im europäischen Mittelfeld eingependelt, liegt also im Trend des allgemeinen Babyschwunds.
Mehr Sex bringt auch keine Kinder
Macht man sich das klar, bekommt das Wort von der »Last Generation« plötzlich eine ganz andere Bedeutung, wobei radikalen Klimaaktivisten diese Entwicklung gar nicht unlieb ist. Weniger Kinder hinterlassen weniger CO2–Fußabdrücke. Auch Hardcore-Feministinnen halten Kinderlosigkeit für einen Ausdruck selbstbestimmten Lebens: »Empty Planet«, ein schöner, leider leerer Planet. Ein Bevölkerungswachstum gibt es inzwischen nur noch in den armen Ländern Afrikas.
Was soll man tun? Gar nichts, hätte mein journalistischer Lehrer Hans D. Barbier gesagt. Wenn die Menschheit beschließt, sich ein Ende zu machen, sind dies viele freie Einzelentscheidungen, die zu korrigieren niemand sich anheischig machen sollte. Deutsche, die in der Nazizeit großgeworden sind, sind besonders sensibel gegenüber einer völkischen Gebärförderungspolitik. Doch in den meisten Ländern wollen die Politiker den Rückgang der Bevölkerung nicht hinnehmen und steuern mit allerlei Maßnahmen dagegen. Dazu zählen ein höheres Kindergeld, Nachlässe bei der Einkommensteuer, vom Staat oder den Unternehmen bezahlte Erziehungszeiten und vieles mehr.
Bei all diesen Maßnahmen handelt es sich um Reaktionen auf die historische Falsifizierung des berühmten Diktum von Konrad Adenauer, wonach die Leute Kinder »von alleine« kriegen. Jetzt muss der Staat nachhelfen. In Korea hat die Regierung ihre Bürger zu mehr Sex ermuntert (»Geht früher heim!«), was womöglich funktioniert, nur nicht zu mehr Kindern führt. Die meisten Länder versuchen es mit Geld- und Zeitgeschenken. Italien, wo es junge Familien besonders schwer haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden, hat unter der Regierung von Mario Draghi große Anstrengungen unternommen, den Trend zu stoppen oder gar umzukehren. Eltern erhalten, abhängig vom Einkommen, für ein Neugeborenes zwischen 50 und 175 Euro monatlich. In Deutschland wird über eine Ausweitung des Mutterschutzes und die Einführung einer Kindergrundsicherung diskutiert.
Doch das nützt alles nichts – jedenfalls nicht für die Fertilitätsrate. Die Korrelation ist negativ. Je mehr Geld die Staaten für mehr Kinder in die Hand nehmen, umso weniger Kinder kommen auf die Welt. 1980 beliefen sich die familienpolitischen Ausgaben der OECD-Länder auf 1,6 Prozent des Bruttosozialprodukts. Damals lag die Fertilitätsrate bei 2,2. Inzwischen wurden die Ausgaben auf 4,2 Prozent des BIP gesteigert, während die Fertilität auf 1,6 gefallen ist.
Wirken all die familienfreundlichen Maßnahmen inklusive großer finanzieller Incentives nicht? Wäre es so, müsste das nicht nur die ökonomische Wissenschaft in eine tiefe Krise stürzen; auch unser Alltagswissen wäre schwer irritiert. Denn im sonstigen Leben wirken finanzielle Anreize eigentlich immer – denken wir an Gehaltsverhandlungen, Rentenerhöhungen, Steuervermeidungsstrategien oder das 9–Euro-Ticket. Verbreitet ist die Meinung, es gäbe immer noch zu wenig Geld und Betreuungseinrichtungen. Eine schwache, bei Politikern gleichwohl beliebte Erklärung, finde ich.
Was dann? Forscher des Max-Planck-Instituts haben mir dankenswerterweise eine kommentierte Liste kluger Papers geschickt. Wie immer geht es darum, ob die Gesellschaft oder die Menschen verantwortlich sind. Womöglich hat ein nüchterner Individualismus das Kosten-Nutzenverhältnis von Elternschaft zugunsten einer (womöglich falsch verstandenen) Selbstverwirklichung neu justiert? Womöglich bleiben – aller Vereinbarkeitsrhetorik zum Trotz – Beruf und Familie in einem Spannungsverhältnis, das zugunsten der Berufsarbeit aufgelöst wird. Das Phänomen der »Child Penalty« besagt, dass Frauen nach dem ersten Kind gehaltsmäßig von den Männern abgehängt werden – bei zuvor gleichen Start-, Ehrgeiz- und Karriereerfolgen.
Befriedigend sind diese Mutmaßungen alle nicht. Nur eines ist gewiss: Noch mehr Staatsgeld, bringt auch nicht mehr Kinder auf die Welt.
Rainer Hank
03. Mai 2023
Darf man noch alles sagen
Überlegungen zum Stellenwert der Freiheit
Ostern sei das Fest der Freiheit, heißt es: Ein Anlass darüber nachzudenken, wie es um die Freiheit steht – in der Welt im Allgemeinen und bei uns in Deutschland im Speziellen. Nicht besonders gut, um die Antwort vorwegzunehmen.
Beginnen wir mit der Philosophie, bevor wir zu den Statistiken wechseln. Wir leben in einer Zeit der gescheiterten Befreiungen, so beginnt der Frankfurter Philosoph Christoph Menke seine jüngst erschienene, sehr lesenswerte »Theorie der Befreiung«: »Alle Befreiungen, die die Moderne seit ihrem Beginn hervorgebracht hat, haben sich – früher oder später – in ihr Gegenteil verkehrt«, klagt Menke: Sie haben neue Zwänge, neue Ordnungen der Abhängigkeit und Knechtschaft hervorgebracht. Es ist eben leider nicht so, dass sich die Menschheit seit ihren Anfängen aus der Knechtschaft befreit und am Ende eines langen Weges schließlich im Reich der Freiheit landet. Stattdessen sind Freiheit und Knechtschaft ineinander verstrickt. So hat die Befreiung von äußerer Bevormundung (durch Familie oder Religion) zu neuen Formen der Selbstkontrolle und Selbstdisziplin geführt. Trauen wir uns, so zu leben, wie wir wollen? Dürfen wir so frei reden, wie wir gerne würden? Das scheint jedenfalls nicht mehr eindeutig bejaht zu werden in einer Welt, in der äußerer Gruppendruck und die Erwartung hoher Gruppenloyalität sich in unseren Köpfen als »Schere« eingenistet hat.
Breaking Bad oder Exodus
Menke erzählt von dieser Ambivalenz anhand der Geschichte des Chemielehrers Walter White aus der Serie »Breaking Bad«, der sich vorgenommen hat, aus der Knechtschaft der Gewohnheit auszubrechen und ein selbständiges und freies Leben zu führen. Am Ende gerät White auf die schiefe Bahn und wird zu einem ruchlosen Drogenboss. Frei ist, wer nicht gezwungen wird, sondern selbst seine Ziele wählen kann. Menke deutet Walter White als Gefolgsmann der Lehren von Immanuel Kant und Friedrich A. von Hayek, also als eine Inkarnation neoliberaler Befreiung. Neoliberalismus, so erwarten wir es von einem Philosophen der »Frankfurter Schule«, kann natürlich am Ende nicht gut gehen. Die Befreiung zur Selbständigkeit, die »Breaking Bad« erzählt, nennt Menke »systemkonform«. Der freie Serien-Held landet in einer neuen Abhängigkeit, weil er sich aus freien Stücken quasi zwanghaft um die Mehrung seines Geldvermögens sorgt.
Als Gegenmodell zum liberalen Freiheitskonzept bringt Philosoph Menke die Exodus-Erfahrung der Bibel ins Gespräch: Die Befreiung Israels aus der Knechtschaft Ägyptens, in der Tat eine radikale Ostererzählung. Danach wäre die Freiheit kein Akt des individuellen Wollens – wie im Liberalismus -, sondern ein Widerfahrnis bezogen auf einen transzendenten Höchsten, dessen Gebot und Gesetz zu gehorchen ist. Am Ende landet also auch die religiöse Erfahrung wieder in der Unfreiheit. Das ist nicht schön und ziemlich dialektisch.
Wechseln wir von den Höhen der Philosophie in die Niederungen der Empirie, um zu fragen, wie es denn tatsächlich um die Freiheit hierzulande und im Rest der Welt steht. Dazu braucht es keine Definition der Freiheit, sondern saubere Umfragemethoden. Die kann man von den Meinungsforschern aus Allensbach am Bodensee bekommen, die derzeit zusammen mit dem »Media Tenor«, einem auf Inhaltsanalysen von Medien spezialisierten Unternehmen, an einem neuen »Freiheitsindex« arbeiten.
Freiheit war stets dort am besten aufgehoben, wo sich Marktwirtschaft und Demokratie paaren. Dass diese Freiheit allenthalben auf dem Rückzug ist, lässt sich nicht übersehen. »Freedom House«, ein Thinktank in Washington, registriert in seinem jüngst vorgelegten Überblick für das Jahr 2022 zum siebzehnten Mal in Folge einen globalen Rückgang der Freiheit und eine Zunahme autoritärer Regime. Es gibt Jahr für Jahr mehr Länder, in denen die Freiheit eingeschränkt wird, verglichen mit Staaten, in denen es sich freier leben lässt. Deutschland ist ein freies Land, aber in anderen europäischen Ländern rangiert die Freiheit höher als bei uns: Ganz vorne bei den bürgerlichen Freiheitsrechten sind Finnland, Schweden oder die Schweiz, bei der Achtung wirtschaftlicher Freiheit sind Taiwan, Singapur und abermals die Schweiz auf den Spitzenplätzen. So halten inzwischen nur noch 47 Prozent der Deutschen Freiheit für den höchsten Wert (es waren schon einmal über 50 Prozent), während für 41 Prozent die Gleichheit Priorität hat. Das könnte im Umkehrschluss darauf deuten, dass die Menschen bereit wären, im Konflikt um der Gleichheit willen Einschränkungen der Freiheit hinzunehmen.
Besser vorsichtig sein
Während dieses schwache Freiheitsengagement der Deutschen seit langem bekannt ist, lassen zwei weitere Ergebnisse der Allensbach-Befragung aufhorchen. Auf die Frage, »wie empfinden Sie ihr gegenwärtiges Leben – fühlen Sie sich frei oder unfrei?« – gaben 2022 lediglich 45 Prozent an, dass sie sich frei fühlen. Im Jahr 2017 lag dieser Wert schon einmal bei 51 Prozent; 2021 gab es einen Tiefpunkt bei 36 Prozent.
Es kommt noch dicker: Lediglich 32 Prozent der Deutschen waren 2022 der Meinung, man könne hierzulande seine Meinung frei sagen. 48 Prozent finden, man solle besser vorsichtig sein. So etwas gab es noch nie. 1990, im Jahr der Wiedervereinigung, meinten 70 Prozent, sie könnten ihre Meinung frei sagen, lediglich 18 Prozent rieten zu Vorsicht. Seither nähern die beiden Kurven sich an, bis sie sich vor zwei Jahren geschnitten haben. Roland Schatz, Chef von Media-Tenor, macht die Pandemie für dieses bedrückende Resultat verantwortlich. In zwei Lockdown-Jahren blieben tagtäglich die Corona-Meldungen in Fernsehen und Presse oberhalb der Aufmerksamkeitsschwelle und haben in der Breite der Bevölkerung den Eindruck verstärkt, es sei mit hohen Kosten verbunden, gegen Impfnötigung und weitere Freiheitseinschränkungen zu opponieren. Heute, wo selbst der Gesundheitsminister über Impfschäden spricht, segelt das Thema leider wieder unter dem Aufmerksamkeitsradar. Das heißt, eine Aufarbeitung der Zeit der Unfreiheit nach Maßstäben der Verhältnismäßigkeit dringt nicht durch, selbst wenn sie stattfindet.
Philosophie und Empirie treffen sich an einem zentralen Punkt: Freiheit ist prekär; stets droht sie in Unfreiheit umzuschlagen. Und Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Christoph Menke, der Philosoph der Freiheit, musste das am eigenen Leib erfahren: Als Mitunterzeichner des offenen Briefs für einen baldigen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen in der Ukraine, pfiff ihm der Wind des Widerstands scharf um die Ohren. »Die Reaktionen waren heftig,« bekannte er in einem Interview. Freiheit sei immer die Freiheit der Andersdenkenden, so geht das berühmte Zitat von Rosa Luxemburg, die selbst für den Sozialismus und also gegen Freiheit kämpfte. Freiheit, wie gesagt, ist prekär.
Rainer Hank
